(David Berger) Dieser Aufsatz geht auf einen Vortrag an der Päpstlichen Hochschule „Angelicum“ in Rom zurück, den ich dort anlässlich des Internationalen Thomistenkongresses gehalten habe.
Die Anthropologie des Aquinaten sieht sich in der deutschsprachigen Mediävistik einem harten Urteil ausgesetzt, das allen Einschätzungen der Thomistenschule über das Denken des Thomas Hohn zu sprechen scheint. Es stammt von dem sehr einflussreichen deutschen Philosophiehistoriker Kurt Flasch.
In seiner Philosophiegeschichte postuliert er, dass im Hinblick auf das Denken des Thomas von einer „einheitlichen Anthropologie … aufs Ganze gesehen keine Rede sein“ könne. Vielmehr sei es – ähnlich wie bei Albertus Magnus – geradezu das Proprium der Anthropologie des Aquinaten, dass sie „in dem Reichtum nicht-koordinierter Motive“ bestehe.
Wir werden im Folgenden dieses Vorurteil kritisch hinterfragen, indem wir die Anthropologie des Aquinaten nicht isoliert, sondern eingeordnet in ihren systematischen Kontext, als Teilaspekt seines ganzen Denkens und Verwirklichung der von ihm kunstvoll durchgehaltenen Methode betrachten, um dann in einem zweiten Schritt Einzelaspekte, an denen die genannte Methode ihre Verwirklichung findet, mehr anzudeuten als erschöpfend darzustellen.
„Analektik“ als Methode des Thomismus
Wir haben bereits erwähnt, dass die Einschätzung Flaschs das Urteil der gesamten neueren Thomistenschule über die Denkform des Aquinaten gegen sich hat. Nicht nur Thomas selbst erklärt immer wieder als sein ausdrückliches Ziel, ein möglichst perfekt durchstrukturiertes, durch die media via klar proportioniertes Lehrgebäude zu errichten. Johannes a S. Thoma hat diesen Gedanken in seiner Isagoge ad D. Thomae Theologiam meisterhaft aufgegriffen und zeigt uns Thomas als Architekten einer faszinierenden Synthese. Auch Charles-René Billuart charakterisierte die thomistische Theologie treffend: „… non declinans neque ad dexteram, neque ad sinistram, sed media via, eaque regia et tuta inter utrinque syrtes incedens.“ Und der große Kölner Theologe Matthias Joseph Scheeben bemerkt, die thomistische Methode von jener des Skotismus abhebend:
„…dass die Auffassung des heiligen Thomas eine streng organische ist, d.h. bei aller Feinheit der Distinktion doch die unterschiedenen Momente nicht auseinanderreißt, sondern sie in ihrer natürlichen lebendigen Verbindung lässt, während Scotus mit dem Seziermesser seiner Distinktion ihre organische Verbindung lockert.“
Und Pater Garrigou-Lagrange schreibt – ausgehend vom Aufbauplan der Summa theologiae und der Anordnung der Argumente in deren einzelnen Quästionen – in der Einleitung zu seinem Summenkommentar die vorstehenden Charakterisierungen weiter differenzierend: „Positio sancti Thomae, si recte intellegitur, apparet ut justum medium et culmen inter ac supra duo extrema ad invicem opposita … methodus sancti Thomae est organica, et secundum naturalem mentis processum …“
Dabei ist diese media via – genauso wenig wie sie Produkt eines dialektischen Prozesses der Auf-hebung ist – eine solche des Kompromisses oder der neutralen Unentschiedenheit, die eklektisch aus verschiedenen, sich widersprechenden Positionen ein Gemisch erstellen. Ihr Sowohl-als-auch liegt viel mehr über (supra) als zwischen (inter) den Extremen, denen sie immer schon vorweg ist.
Wie die Gipfel der Berge majestätisch weit über den nebligen Tiefen der sie umgrenzenden Täler, so erhebt sich die von ihr gefundene Synthese unendlich weit über das Spannungsgefüge, das These und Antithese als Contrarien (nicht Contradiktorien!) aufgebaut haben.
Es war dem deutschen Philosophen Bernhard Lakebrink (1904-1991) vorbehalten für diese Eigenart einen treffenden Begriff zu prägen: den der Thomistischen Analektik. Dieser Terminus geht von einer Gegenüberstellung der Hegelschen Ontologie, die den rationalistischen Deduktionalismus Spinozas ebenso in sich aufgenommen hat wie den apriorischen Deduktionalismus Kants, mit dem thomistischen Denken aus. Dies in der Überzeugung, dass die Hegelsche Philosophie sich selbst zurecht als „das Konzentrat neuzeitlichen Philosophierens“ begreift und daher im modernen Denken eben jene Stelle innehat, die Thomas von Aquin für das Mittelalter, aber darüber hinausgehend für die gesamte philosophia perennis besitzt.
Thomas und Hegel werden so verstanden als die „ragenden Gipfel zweier Welten“, deren Vergleich zu tiefen Einsichten in ihr jeweiliges Denken führen kann, gemäß dem Grundsatz des Thomas selbst: „contraria iuxta se posita magis elucescunt“ (Ia-IIae q.42 a 5 ad3).
Dabei ergibt sich freilich die Schwierigkeit, dass Hegel über seine Methode zahlreiche Aussagen gemacht und sie selbst als „Dialektik“ bestimmt hat. Ganz anders Thomas, der eine solche „Reflexion der philosophischen Reflexion“ nicht durchgeführt hat.
Den Grund dafür sieht Lakebrink im thomistischen Objektivismus: Dieses „hatte für eine solch reflexive ‚Er-innerung’ der Methode selbst gleichsam keine Zeit.“ Er handhabt vielmehr „seine Methode mit der instinktiven Sicherheit des Genies“. Es ist nun Sache des modernen Denkens und seiner Reflexion über die Methode, sein Interesse Thomas zuzuwenden und sein Denken auf seine Methode hin zu befragen.
Was mit „Analektik“ genau gemeint ist, definiert Lakebrink folgendermaßen:
„Eine natürliche und ungezwungene Haltung und Ausgeglichenheit dem Kosmos gegenüber, die Absage an alles Extreme, der Blick aufs Ganze, dessen Priorität vor allen Teilen, mag es innerhalb dieses Ganzen noch so gespannt und unterschiedlich zugehen“
– diese Methode der Zusammenschau alles dessen, was ist, dieses Gespür für die netzartige Verwandtschaft aller Dinge und die Organizität des Seienden im Ganzen, den ständigen Versuch, im noch so Differenten die ursprüngliche Mitte auszuloten, dieses Denken, das nichts übersieht, allem Sein das Seine gewährt und seinsgerecht verfährt, nicht gewalttätig und konstruktivistisch, sondern bescheiden und anpassungsfähig sich verhält im Umgang mit den Dingen, diese Schmiegsamkeit und Liebe zum ‚sanften Gesetz’, dieses Denken, das die Wahrheit niemals setzt, wohl aber sich ihr fügt in Einvernahme und Adäquation, den Geist dieses Denkens nennen wir Analektik.“
Der Begriff ist natürlich im bewussten Gegensatz zu jenem der Dialektik konstruiert, die sich als das gerade Gegenteil dieses Denkens zeigt: hat sie doch gerade nicht „die ursprüngliche Mitte in allen Unterschieden im Blick, sondern ist immer nur aus auf die extreme Verschärfung alles Differenten zu Wechselseitig-Negativem und überspanntem Widerspruch, auf dass die so überreizten Gegensätze zusammenschlagen zu aufhebender Identität, in der sie unversöhnt und friedlos gären, um zu neuem Zwiespalt und abermaligem Zerwürfnis aufzubrechen.“
Lebt die Hegelsche Dialektik so vom absoluten Widerspruch, von der gleichermaßen unrealistischen wie unkritischen „Identifizierung des Nicht-Identischen als des Sich-Widersprechenden“, vom „feindseligen Extremismus gedachter Positionen, der Unerbittlichkeit jäher Umschwünge im Begrifflichen, dem ‚wilden Wechsel’ (Hegel, Logik, II, 112) in Ding und Denken“;
… von der duplex negatio, die als solche stets „umschlagen muss in die alle Unterschiedenheit vernichtende Identität“ resp. eine monistische Konfundierung von Kausalität und Finalität, Gott und Welt, Protologie und Eschatologie, Gnade und Natur;
So finden wir beim Aquinaten eine Methode, die stets die schon vor allem Denken mit dem Sein selbst gegebene Mitte, den „lentus passus“, die media via zwischen den Extremen sucht. Denn – und dies ist das die Methode des Thomismus gut umschreibende Leitmotiv: „fides autem catholica media via incedit …“ (Ver q.24 a.12).
Während der Widerspruch die Mitte der Dialektik besetzt hält, ist das Herz der Analektik die Kategorie der Verhältnis-Ähnlichkeit, der „similitudo et dissimilitudo simul“ (ScG l.1 c.29).
Dies ist die Grundstruktur, die dem vielgerühmten Ordnungsdenken des hl. Thomas, der „merveilleuse ordonannce“ (Etienne Gilson) seines Werkes, welche die der Wirklichkeit eigene mirabilis rerum connexio (ScG l.II, c.68) im Denken widerspiegelt, zugrunde liegt.
Diese Ordnung lebt aus einer sehr differenzierten und festgefügten Hierarchie mit klarer Über- und Unterordnung. Alle Stufen der analektischen Ordnungswelt sind aufs feinste und beständigste untereinander abgestimmt; aber ein solches superpositionales Denken führt niemals zur Knechtung oder gar Zerstörung eines ihrer Ordnungselemente. Es ist die Ähnlichkeit, die dies verhindert und von der gilt: „superius habet similitudinem cum inferiori“ (Ia q.52 a.2 ad 2).
„Die Ähnlichkeit wird somit zum gegensatzmildernden Medium, in dem Wirklichkeit und Möglichkeit, Stoff und Form, Ursache und Wirkung, Ding und Denken, Gott und Welt, immer schon vermittelt sind und ineinander scheinen. Jede dieser Proportionen, weil innerlich in ihrer Gegensätzlichkeit doch nach dem Gesetz der Ähnlichkeit gefügt, scheint nunmehr auch über sich hinaus in alle anderen. Diese transzendentale similitudo proportionalitatis (Ver. q.2 a.11 ad 4) vermittelt alles mit allem und lässt doch ein jedes im Gegensatz zur dialektischen Identifizierung in seiner Eigenheit bestehen.“
Aspekte der Analektik in der Anthropologie des Aquinaten
Lakebrink hat in all seinen Schriften immer wieder auf diese Analektik des thomistischen Denkens hingewiesen. Dabei war er vor allem bemüht, ihr Vorhandensein bei Thomas an den streng metaphysischen Fragen aufzuzeigen. Überlegungen zum Menschenbild des Thomas kommen dabei nur am Rande vor. Aber auch hier spielt die Analektik, wie wir im folgenden zeigen wollen, eine bedeutende Rolle.
 Die grundlegenden Aussagen des Thomas zum Menschen hat dieser in seiner Summa theologiae im Rahmen der Schöpfungslehre behandelt (Ia qq.75- 102). Neben der Vorstellung von Gott als „ipsum Esse subsistens“ ist aber auch hier, in dem Bild, das Thomas von dem Ergebnis der Schöpfungstat, der geschaffenen Welt, entwirft, der die Analektik grundlegende Gedanke des ordo als Urleitmotiv greifbar. Die Schöpfungslehre sagt uns eindeutig, dass es in dieser Welt nichts gibt, das nicht ausnahmslos von Gott stammt. Zugleich liest Thomas im Römerbrief (13,1), dass „alles, was von Gott stammt, geordnet ist“ und er folgert: „Was immer aber von Gott ist, ist unter sich aufeinander und auf Gott hingeordnet.“
Die grundlegenden Aussagen des Thomas zum Menschen hat dieser in seiner Summa theologiae im Rahmen der Schöpfungslehre behandelt (Ia qq.75- 102). Neben der Vorstellung von Gott als „ipsum Esse subsistens“ ist aber auch hier, in dem Bild, das Thomas von dem Ergebnis der Schöpfungstat, der geschaffenen Welt, entwirft, der die Analektik grundlegende Gedanke des ordo als Urleitmotiv greifbar. Die Schöpfungslehre sagt uns eindeutig, dass es in dieser Welt nichts gibt, das nicht ausnahmslos von Gott stammt. Zugleich liest Thomas im Römerbrief (13,1), dass „alles, was von Gott stammt, geordnet ist“ und er folgert: „Was immer aber von Gott ist, ist unter sich aufeinander und auf Gott hingeordnet.“
Darin besteht die höchste Vollkommenheit des Alls, das ihm diese klare Ordnung zugrunde liegt. Die Wirklichkeit ist klar geordnet und von daher auch klar erkennbar, gestuft in ein festes Seinsgefüge, das sich von der untersten, noch ganz der Materie verhafteten Stufe der leblosen Dinge bis zur höchsten Ebene, dem Reich der reinen Geister erstreckt.
So begegnet uns die Welt bei Thomas als eine gestufte, unaufhebbare Einheit, die von der imperfectio bzw. Potentialität der Materie bis zur perfectio bzw. Aktualität der Form ausgespannt ist. Woher erhält nun eine jede Komponente ihren festen Platz in dieser Ordnung?
Und wodurch werden diese Stufen zusammengehalten, so dass sie eine echte Synthese der Wirklichkeit bilden? Die Ordnung der Schöpfung ist bestimmt durch ihren Schöpfer als ihrer umfassenden Ursache. Dieser ist aber von Thomas in der Gotteslehre vor allem als das Sein selbst, als das ipsum esse subsistens erkannt worden. Es ist also eine Ordnung des Seins, in der die Dinge der Schöpfung organisiert sind. Dabei gilt dann: „Je höher der Rang, den ein Wesen im All innehat, desto mehr ist es notwendig, dass es teilhat an jener Ordnung, in welcher das Gut des Alls besteht.“
Je größer das Maß des Seins ist, das das Geschöpf nicht aus sich hat, sondern an dem es sein Schöpfer, als die Quelle allen Seins, teilhaben lässt, um so höher steht es in dieser hierarchischen Ordnung. Dabei ist das Sein nicht als univoker (eindeutiger), sondern als analoger Begriff zu verstehen:
Diese Analogie des Seins (Analogia entis) verhindert durch ihre Nähe und Distanz zusammenzuhaltende Grundstruktur ein vorschnelles undifferenziertes Reden und eine Vermenschlichung Gottes, zugleich hält sie den Menschen doch in der Nähe Gottes und verhindert so ein Auseinanderfallen von Schöpfer und Geschöpf.
Dementsprechend ist die Ordnung, die Thomas in der Schöpfung verwirklicht sieht, nun nicht einfach völlig statisch in dem Sinne, dass jede Seinstufe eine eigene, für sich abgeschlossene Insel bilden würde. Sie ist ausgespannt zwischen einer nur begonnenen und einer noch ausstehenden Vollkommenheit (Ia-IIae q.1 a.6). So strebt die Schöpfung von Natur aus zu ihrem Schöpfer, zur Vollendung, aus der sie hervorgegangen ist, zurück. Bei diesem Streben gibt es eine universale Solidarität der Seinstufen, denn die Ordnung der Dinge zeichnet sich dadurch aus, dass die einen durch die anderen zu Gott geführt werden (Ia-IIae q.11 a.1).
Gott könnte diese Führung von seiner Macht her auch völlig ohne das Zutun des Geschöpfes übernehmen, und doch tut er es nicht: „Es liegt also nicht an einem Mangel seiner Macht, wenn er durch Vermittlung seines Geschöpfes wirkt, sondern an dem Überschwang seiner Güte. Daher kommt es, dass er nicht nur dem Geschöpf mit-teilt, in sich gut zu sein, sondern auch die Würde, für andere Ursache der Güte zu sein.“
Ordnung basiert auf Unterscheidung. Die allgemeinste Unterscheidung jedoch, die sich bezüglich der Schöpfung treffen lässt, ist jene zwischen der rein geistigen und der rein körperlichen Schöpfung. Erst nachdem beide ausführlich behandelt wurden, wendet sich Thomas in seiner Summa dem Menschen zu: Er ist “citoyen de deux mondes“ (J. de Finance).
Wie der Horizont Himmel und Erde vermählt, so steht der Mensch zwischen den beiden Welten nicht als trennender Fremdkörper, sondern als verbindende Mitte, indem er beide in sich vereint. Sehr anschaulich wird dies, wenn Thomas bemerkt, dass in uns „nicht allein die Lust lebt, die wir mit den Tieren, sondern auch die Lust, die wir mit den Engeln gemein haben“.
In dieser Grundoption ist auch Lösung für die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in der deutschsprachigen Thomasforschung so kontrovers diskutierte Frage nach der Lehre des Thomas vom Verhältnis des Individuums zur Gemeinschaft, zu suchen.
Richtig hat hier Erich Przywara bemerkt: „Sieht man den Menschen als die unterste Grenze des Reiches des Geistes, dann wird man mir Vorzug ihn als qualitatives Einzelwesen bezeichnen: mit der Richtung auf eine besondere Selbständigkeit des Individuums gegenüber der Gemeinschaft. Sieht man den Menschen aber als die oberste Grenze des Reiches der Natur, dann wird man ihm den Charakter einer rein formalen quantitativen Einzelung lassen müssen: mit der Richtung auf ein Überwiegen der Gemeinschaft.“
Sieht man beides, wie der Aquinate, synthetisch zusammen, können auch Individuum und Gemeinschaft in ein gesundes analektisches Verhältnis gebracht und die entsprechenden praktischen Konsequenzen – etwa in der damals ebenfalls heiß diskutierten Frage nach dem Eigentumsbegriff – daraus deduziert werden. Die Grundkonzeption des Menschen als Horizont zwischen zwei Welten wird zuerst und vor allem aber an der leibseelischen Natur des Menschen deutlich.
Das Verhältnis von Leib und Seele
Während Plato behauptete – und die christliche Tradition vor Thomas darin überstark beeinflusst hatte –, der Menschen sei die Seele, und damit zwischen Seele und Leib einen dialektischen Gegensatz grund gelegt hatte, so lehrt nun Thomas, hierin eindeutig Aristoteles folgend: „Offenbar ist der Mensch nicht einzig die Seele, sondern eine Seinseinheit aus Seele und Leib.“
Die Seele als das geistige Prinzip ist mit dem Leib als dem materiellen Prinzip zu einer einzigen Natur vereint. Dabei wird diese Vereinigung wie jene von Materie und Form als eine solche zweier komplementärer, sich entsprechender Prinzipien gedacht. Wie die Form generell die Seinsursache der Materie ist, so ist die Seele das Seinsprinzip des Menschen, die Form, die der Materie das Leben und die Form der Körperlichkeit verleiht. Sie ist das einzige Wesensprinzip des Körpers (anima unica forma corporis). Dabei überragt die Menschenseele alle anderen Formen der gemischten Körper, da ihre Kraft – der Verstand (intellectus) – die Materie am weitesten übertrifft, sie ist die „höchste im Adel der Formen“.
So wird auch verständlich, dass zur Seele als der höchsten Stufe der gesamten Schöpfung, die ganze Materie hinstrebt. Während die Materie zur Seele aufstrebt, neigt sich wiederum die Seele aber auch zur Materie nieder.
Denn sie ist auf eine Vereinigung mit dem Körper hin angelegt. Es gehört zur Seele von ihrem Wesen her, dass sie mit dem Leib vereinigt ist. Dieser Gedanke ist Thomas so wichtig, dass er sich sogar strikt gegen die Vorstellung Augustins wendet, die Seele des ersten Menschen sei vor dessen Leib zusammen mit den Engeln erschaffen worden:
Die Seele ist nur ein, wenn auch dem Leib übergeordneter Teil der menschlichen Natur. Sie ist auf den Leib als das ihr zugeordnete Werkzeug, dass sie aller erst in der Welt des Menschen handlungsfähig macht, angewiesen. Nur durch die Verbindung mit dem Leib erreicht sie die ihr von Natur aus zukommende Vollendung.
Der Leib ist trotz seiner Mängel, auf die Seele als das dieser am besten dienende Werkzeug hingeordnet (Ia q.91 a.3). Wie eng Thomas die Verbindung von Leib und Seele sieht, wird deutlich, wenn er im Anschluss an Aristoteles sagt, „dass, je besser der Leib bereitet ist, ihm eine um so bessere Seele zuteil wird“ (Ia q.85 a.7), da ja Akt und Form entsprechend der Kapazität der Materie in diese aufgenommen werden. Hier spiegelt sich die analektische Zuordnung von Materie und Form, die das Denken des Aquinaten richtungsweisend prägt: Die Potentialität der Materie und die Aktualität der Form bilden eine gestufte Einheit, beide Komponenten bestimmen sich gegenseitig entsprechend der Verschiedenheit der Ursachen.
So kann auch Thomas sagen: „Die Materie ist in gewisser Weise Ursache der Form, und in gewisser Weise verhält es sich umgekehrt.“
In dieser Zuordnung von Leib und Seele, die im Unterschied zu der in der damaligen franziskanischen Tradition allgemein verbreiteten Theorie von der Mehrheit der Formen, aber auch im Kontrast zu den Theorien einer psychophysischen Wechselwirkung (Platoniker, Descartes, Leibniz) oder dem Okkasionalismus eines Malebranche, eine echte, substantielle Einheit des Menschen begründen und damit auch eine einheitliche anthropologische Synthese schaffen kann, zeigt sich die der Analektik eigene „priorité mutuelle“ resp. reziproke Kausalität der zu verbindenden Elemente.
Das Leitmotiv, das hier herrschend ist, hat in dem thomistischen Axiom: Causae sunt sibi invicem causae, sed in diverso genere seinen Ausdruck gefunden; das heißt dasselbe kann Ursache und Verursachtes sein, entsprechend der verschiedenen Art der Ursache (Sent IV d.17 q.1 a.4 sol.1).
So entsteht auch bei der Erklärung des Zusammenspiels von Seele und Leib eine „Kreisbewegung, die sich zwischen Ursachen und Verursachtem zufolge der verschiedenen Ursachen findet“ . Oder mit Lakebrink:
„Es ist der analektische Zirkel wechselseitiger Priorität, der Seiendes und Sein, Materie und Form, Leib und Seele, Wille und Verstand ineinander fügt. Dabei wird der Widerspruch nicht durch die Vermittlung der Beziehungsrichtungen ausgeräumt, sondern die innere Gemäßheit und Konvenienz der Seinsprinzipien ermöglicht ein harmonisches Zusammenspiel“.
Dieses harmonische Zusammenspiel zeigt sich in besonderer Weise auch in dem häufig in seiner Bedeutung für die Ergründung der thomanischen Anthropologie übersehenen Traktat „De passionibus animae“ (Ia-IIae qq.22-48): Thomas gelingt es hier, die von ihm rezipierten, bis dahin weitgehend unkoordiniert nebeneinander stehenden Quellen, angefangen von der platonischen Lehre von einer Hierarchie von Seelenteilen und dem aristotelischen Alternativentwurf dazu, über den Eklektizismus der Spätantike bis hin zur Seelenlehre der muslimischen Gelehrten Al-Farabi und Ibn Sina (Avicenna), schlüssig zu einer stimmigen, in sich kohärenten Synthese zu führen: Diese Leistung besteht neben einer außerordentlichen systematischen Klarheit der Darstellung in der gelungenen Überbrückung vorher bestehender Brüche zwischen verschiedenen Denkmodellen; konkret in der Umformung einer ursprünglich platonischen Doktrin zu einer sich in eine Seelenlehre aristotelischen Musters sinnvoll einfügenden Lehre.
Thomas gelingt es, die systematischen Vorzüge unterschiedlicher und schwer kompatibler psychologischer Theorieansätze in einem Modell zu integrieren.“ Dabei kann man mit Italo Sciuto weiter darauf hinweisen, dass sich an dem Traktat de passionibus animae die thomasische Konzeption des Leib-Seeleverhältnisses a fortiori zeigt und so der dort angenommene enge Zusammenhang von seelischem und leiblichem Geschehen, der wiederum das Herz der gesamten thomasischen Anthropologie bildet, besonders deutlich wird. – Womit dann natürlich das genannte negative Urteil Flaschs bezüglich der Anthropologie des Aquinaten im Hinblick auf dessen Traktat von den passiones animae ad absurdum geführt ist.
Allerdings ist dieser Leib, wie Thomas aus der Erfahrung weiß, der Seele nicht, wie es einem Werkzeug zukommt, völlig untertan, deshalb ist er auch vergänglich. Ganz im Unterschied zur Seele. Die Seele des Menschen ist zwar aufgrund ihrer reinen Geistigkeit unzerstörbar bzw. unsterblich, dennoch ist sie nicht ewig, sondern aus dem Nichts von Gott geschaffen.
Dies spiegelt sich in der Tatsache, dass es in ihr – ganz im Unterschied zu Gott, der reinste Wirklichkeit ist, – immer Seinkönnen (Potenz) und Wirklichkeit (Akt) gibt. Dies zeigt sich besonders beim Erkennen des Menschen:
„Die Erkenntniskraft ist im Hinblick auf die erkennbaren Dinge, natürlicherweise im Zustand der Potenz. Bevor sie also zum Wirklichsein geführt wird, ist sie unvollkommen. Sie vollendet sich erst, indem sie die Dinge erkennt und so ins Wirklichsein überführt wird.“
So ist es auch kein Zufall, dass Thomas mit Aristoteles das äußerste Glück des Menschen in der Erkenntnis sieht. Hierher begründet sich auch die Einschätzung des Thomas als eines „Intellektualisten“.
Die häufige Charakterisierung des hl. Thomas als „Intellektualisten“ lässt leicht übersehen, dass dieser gerade nicht den anscheinend gegensätzlichen, doch – wie schon die Geschichte der Stoa zeigt – nicht selten ineinander dialektisch überschlagenden Positionen eines übertriebenen Intellektualismus auf der einen und eines extremen Voluntarismus auf der anderen Seite huldigt.
Auch hier erweist sich die Konzeption des Thomas als souverän über den beiden Extrempositionen liegend. Auf den ersten Blick finden sich bei Thomas Aussagen, die als Beleg für beide Extrempositionen dienen könnten. So lesen wir: „Der Verstand ist im Verhältnis zum Willen das erste.“ Oder: „Das Wollen muss der Beschaffenheit der Wahrnehmung folgen.“
Und in seinem Kommentar zum Johannesevangelium vergleicht Thomas im Anschluss an den hl. Kirchenvater Augustinus den Willen gar mit der Frau, den Verstand mit dem Mann:
„Der Wille empfängt und gebiert von dem ihn bewegenden Auffassungsvermögen; daher ist der Wille gleichsam wie eine Frau, der den Willen bewegende Verstand jedoch ist ihr Mann.“
Auf der anderen Seite schreibt Thomas in seinen Quaestiones de Potentia , dass das ganze Bewegen der Vernunft im Willen liegt, und in De Veritate, 44 Ver q. 20, a. 3, „dass der Verstand durch den Willen zu etwas bestimmt wird“
Und metaphysisch exakter unter Zugrundelegung der fundamentalen Lehre von Akt und Potenz: „Der Wille überführt jede Potenz in ihren Akt. Wir erkennen nämlich, weil wir wollen, und stellen uns vor, weil wir wollen.“ Thomas verbindet nun die Optionen der Vorordnung des Intellekts vor dem Willen einerseits und jener des Willens vor dem Intellekt andererseits gerade nicht durch das dialektische „entweder-oder“, sondern durch das dialektische et-et.
Sie werden stets als ad invicem ordinatae (Ver 22,13) betrachtet, da sie ihre gemeinsame Verwurzelung in der beide umfassenden mens des Menschen haben und sich so zur Seele sicut actus primus ad secundum (ScG II cap.60) verhalten. Dies zeigt schon der interessante wechselweise Gebrauch der Begriffe appetitus intellectivus und intellectus appetitivus dort, wo Thomas im Anschluss an den Stagiriten das Wesen der freien Entscheidung erklärt (Ver 24,4).
Ähnlich äußert er sich auch in der Summa theologiae: „Das Denken denkt vom Willen her, und der Wille will denken.“ Noch deutlicher wird es wieder, wo Thomas Intellekt und Willen als zwei Potenzen in ihrer Hinordnung zum Akt erklärt:
„Die Vernunft bewegt in gewisser Weise den Willen, und der Wille die Vernunft … So ist jedes der beiden früher als das andere, und jedem kann, mit Beziehung auf das andere ein Akt zugeschrieben werden.“
Jeder der beiden Potenzen kommt der Primat unter jeweils bestimmter Hinsicht zu: dem Willen, insofern sein Primat im Hinlenken (inclinatio) besteht; der Vernunft, indem diese die Ausführung der inclinatio durch diesen oder jenen anordnet und bestimmt (Ver 22,12 ad 4). Entsprechend gehen sich beide in verschiedener Weise wechselseitig voran: „Der Verstand geht dem Willen im Empfangen voraus; denn damit etwas den Willen bewegen könne, muss es erst im Verstand aufgenommen werden … Doch im Bewegen oder Tun ist der Wille früher, denn jede Tätigkeit oder Bewegung geht aus dem Streben nach dem Guten hervor.“
Durch dieses reziproke Sichvorhergehen entsteht auch hier wieder eine Art motus circularis (Ver 22,12 ad 1), in dem der Wille und die Erkenntnis „sich gegenseitig durchdringen und wo jeder mehr und mehr er selbst wird dank dem anderen.“ Mit Joseph de Finance kann man hier also durchaus von einer „gegenseitigen Immanenz“ oder mit Hans-Karl Rechmann von einer bis „zur Perichorese reichenden Möglichkeit einer reziproken Kausalität“ von Wollen und Erkennen sprechen. Diese aber stellen wiederum, wie bereits dargelegt, grundlegende Konstitutiva analektischen Vermittlungsdenkens dar.
Natur und Gnade
Thomas hat keinen geschlossenen Traktat über das Verhältnis von Natur und Gnade vorgelegt. Doch ist die in den letzten zwei Jahrhunderten vieldiskutierte Frage ohne Zweifel auch für ihn – nicht zuletzt dort, wo er die biblisch-dogmatische Lehre von der gestuften Gottebenbildlichkeit des Menschen rezipiert – von fundamentaler Bedeutung. Ohne ihre Kompliziertheit verdecken zu wollen, kann man doch zwei Leitmotive, welche die besonders von der thomistischen Schule im Anschluss an den engelgleichen Lehrer vertretene Doktrin von Natur und Gnade prägen, festhalten. Zunächst:
Zwischen Natur und Gnade ist strikt zu unterscheiden (Unterschied quoad substantiam). Zwischen beiden besteht eine Distanz ohne Maß. Obgleich, oder besser: gerade weil der Aquinate eine tiefe Ehrfurcht vor der Schöpfung, eine große Vorstellung von der von Gott geschaffenen Natur und der natürlichen Vollkommenheit des Menschen hat, betont er doch immer wieder: Die Gnade als wirkliche und formelle Teilhabe am ungeschaffenen innergöttlichen Leben, am subsistierenden Übernatürlichen, ist unendlich weit über die geschaffene Natur erhaben.
Eine einzelne Gnade, etwa eines Kindes nach dem Empfang des Taufsakramentes, überragt alle irdisch-natürlichen Güter zusammen genommen um ein Unendliches. Thomas lehrt daher ganz folgerichtig, dass es etwas unendlich Größeres ist, wenn Gott einen Sünder wieder zur Gnade zurückführt, als wenn er Himmel und Erde erschafft.
Daher spricht man von der Gnade als von einem strikt übernatürlichen Gut. Das heißt keine geschaffene oder auch nur erschaffbare Natur, und sei sie noch so vornehm und edel, weder die des Menschen noch des vollkommensten Engels, hat auch nur den winzigsten Keim zu einem solchen übernatürlichen Leben in sich.
 Die Gnade übersteigt die Kräfte und Ansprüche jeder geschaffenen Natur um ein Unendliches. Ja, die angesehensten Gottesgelehrten gehen mit Thomas an ihrer Spitze (Ia q.12 a.3) sogar soweit zu sagen, Gott könne trotz seiner Allmacht und absoluten unbegrenzten Freiheit kein Geschöpf hervorbringen, dem die Gnade natürlich wäre, da sich eine solche Kreatur nicht mehr von Gott unterscheiden würde. Zudem wehrt die konsequente Unterscheidung von Natur und Gnade der stets lauernden Versuchung des Pelagianismus, der den Beginn der Gnade durch die Natur bewirkt sieht:
Die Gnade übersteigt die Kräfte und Ansprüche jeder geschaffenen Natur um ein Unendliches. Ja, die angesehensten Gottesgelehrten gehen mit Thomas an ihrer Spitze (Ia q.12 a.3) sogar soweit zu sagen, Gott könne trotz seiner Allmacht und absoluten unbegrenzten Freiheit kein Geschöpf hervorbringen, dem die Gnade natürlich wäre, da sich eine solche Kreatur nicht mehr von Gott unterscheiden würde. Zudem wehrt die konsequente Unterscheidung von Natur und Gnade der stets lauernden Versuchung des Pelagianismus, der den Beginn der Gnade durch die Natur bewirkt sieht:
„Zwischen beiden Ordnungen besteht kein positives Verhältnis, und deshalb können die natürlichen guten Werke die göttliche Gnade absolut nicht verdienen, noch positiv auf sie vorbereiten.“ Die uns durch die unendlichen Verdienste Christi geschenkte Gnade ist wirksam durch sich selbst, nicht kraft unserer Zustimmung.
Vielmehr ist sie es bereits, die uns in feinster Zartheit und zugleich mit höchster Kraft bewegt, in Freiheit dem Gnadengeschenk Gottes zuzustimmen. Die klassische Theologie, und hier besonders der Thomismus, hat diese klare Unterscheidung von Natur und Gnade stets wie ihren Augapfel gehütet. Das Lehramt der Kirche hat ihn im Ersten Vatikanischen Konzil mit der Lehre vom duplex ordo cognitionis endgültig festgeschrieben (DH 3015).
Ganz abgesehen davon, dass sie Dogma ist, hat die absolute Gratuität der Gnade aber auch heute einen kaum zu überschätzenden didaktischen Wert. Richtig bemerkt der große Kölner Dogmatiker Matthias Joseph Scheeben: „Je mehr sich die Möglichkeit eines Gutes bei den Geschöpfen von selbst versteht, desto weniger erregt und verdient es unsere Verwunderung und Bewunderung; nur das Unerwartete, Außerordentliche, unsere Begriffe und Erwartungen Übersteigende bewundern wir.“
Interessant scheint es in diesem Zusammenhang, dass Thomas die Ursünde nicht so sehr in dem Verlangen sieht, so sein zu wollen wie Gott, sondern vielmehr in der Vorstellung, die visio beatifica ohne die Gnade, allein aus eigener Kraft, erlangen zu können. Die klare und konsequente Unterscheidung, die der Thomismus im Anschluss an den engelgleichen Lehrer zwischen Natur und Gnade vindiziert, hat manche Theologen des 20. Jahrhunderst dazu veranlasst, den Thomismus für die radikale Trennung von Natur und Gnade, von Philosophie und Theologie, von Welt- und Gottesdienst in der Neuzeit verantwortlich zu machen.
Dabei hat man nicht nur den feinen Unterschied übersehen, der zwischen Trennung und Distinktion besteht. Auch, dass sich Einheit und Unterscheidung gegenseitig fordern, dass nur der zur vereinenden Synthese fähig ist, der vorher alles sorgfältig geordnet unterschieden hat, ist ihnen völlig entgangen. Und in der Tat begegnet uns sowohl bei Thomas selbst wie in dem besten, was die thomistische Tradition zu bieten hat, die feste Überzeugung von einer erhabenen Harmonie der beiden Ordnungen. Sie hat als Grundlage den vielzitierten Satz: gratia perficit naturam: Die Natur soll durch die Gnade nicht zerstört, sondern vervollkommnet werden.
Wie muss man sich diese Vervollkommnung denken? Weder rein äußerlich noch als bloße Potenzierung oder Verlängerung des rein Natürlichen. Natur und Gnade verbinden sich, wenn die Seele mit der heiligmachenden Gnade geschmückt wird, nicht nur äußerlich miteinander. Auch wenn die Gnade bei der Begnadigung des Menschen immer als Quasi-akzidenz zur Natur hinzutritt, so schenkt sie als entitativer Habitus der menschlichen Natur doch eine übernatürliche Teilnahme an der ungeschaffenen göttlichen Natur, die den Menschen selbst in physischer und ontologischer Weise vergöttlicht (Ia-IIae q.112 a.1).
 Diese ontologische und physische Vergöttlichung besteht darin, dass der ewig in der Trinität der Personen selige Gott, das subsistierende Übernatürliche, in einer neuen, übernatürlichen Ordnung vom Menschen erkannt und geliebt wird, wie er sich selbst erkennt und liebt (Ia q.43 a.3). Sie macht uns, wie der zweite Petrusbrief sagt, zu consortes divinae naturae (2 Petr 1,4). Dabei besitzt der Mensch zwar keinen Keim des Übernatürlichen, der durch diese Begnadigung gleichsam in seinem Wachstum gefördert würde, aber er hat, wie die Theologie sagt, eine passive und aus sich unwirksame Fähigkeit, Anlage oder Hinordnung zur beseligenden Gottesschau und damit auch einen Anknüpfungspunkt für das Wirken der göttlichen Gnade. Diese Anlage fällt mit der potentia oboedientialis zusammen, d.h. der passiven Eignung jeder Kreatur dem Wirken Gottes vollkommen zu entsprechen, empfangen zu können, was Gott schenken will.
Diese ontologische und physische Vergöttlichung besteht darin, dass der ewig in der Trinität der Personen selige Gott, das subsistierende Übernatürliche, in einer neuen, übernatürlichen Ordnung vom Menschen erkannt und geliebt wird, wie er sich selbst erkennt und liebt (Ia q.43 a.3). Sie macht uns, wie der zweite Petrusbrief sagt, zu consortes divinae naturae (2 Petr 1,4). Dabei besitzt der Mensch zwar keinen Keim des Übernatürlichen, der durch diese Begnadigung gleichsam in seinem Wachstum gefördert würde, aber er hat, wie die Theologie sagt, eine passive und aus sich unwirksame Fähigkeit, Anlage oder Hinordnung zur beseligenden Gottesschau und damit auch einen Anknüpfungspunkt für das Wirken der göttlichen Gnade. Diese Anlage fällt mit der potentia oboedientialis zusammen, d.h. der passiven Eignung jeder Kreatur dem Wirken Gottes vollkommen zu entsprechen, empfangen zu können, was Gott schenken will.
Dass bei dieser wunderbaren Vergöttlichung angesichts der absoluten Heiligkeit Gottes im Menschen keinerlei Sünde neben der heiligmachenden Gnade zurückbleiben kann und von daher ein Kompromiss mit dem lutherischen simul justus et peccator ausgeschlossen ist, ist leicht einsichtig: In einem Augenblick wird so bei der Rechtfertigung des Menschen zugleich die Gnade eingegossen, der Wille zu Gott hin- und von der Sünde abgewendet und die Schuld nachgelassen. Umgekehrt geht mit jeder Todsünde der Gnadenstand zugleich verloren (Ia-IIae q.113 a.3-7).
Die von Thomas zitierten Väter haben die innige Verbindung von Natur und Gnade mit beeindruckenden Bildern, häufig aus dem Bereich des Kultes, beschrieben:
Wie der Duft des Balsams die eingeriebene Dinge ganz mit seinem Wohlgeruch durchdringt (Athanasius), wie das Siegel im weichen Wachs seine Gestalt eindrückt, wie der Tropfen Wasser, der in den Wein gegeben wird, ganz in diesen eingeht und seine Farbe, seinen Geschmack und Geruch annimmt (Gregor von Nazianz), wie die dunkle, kalte Luft der Nacht bei Sonnenaufgang vom Sonnenlicht erfüllt und so erleuchtet wird (so Thomas selbst am häufigsten), ja, wie die Seele die Form des Leibes und mit diesem zu einer substantiellen Einheit, einem organischen Ganzen verbunden ist, so vermählen sich Natur und Gnade bei der Begnadigung der von Gott Erwählten.
Die hypostatische Union als letzte Krönung der Analektik
Die Begnadigung des Menschen ist zwar unermesslich wunderbar und übernatürlich. Sie ist aber nicht der Höhepunkt und das Zentrum der Vermählung von Natur und Gnade. Dieses bildet vielmehr die Verwirklichung des Gott-menschlichen Prinzips in Jesus Christus, der als einziger Mittler Quelle aller Vermittlungen ist bzw. alle anderen Personen dispositive vel ministerialiter am Heilswerk teilhaben lässt (IIIa q.26 a.1):
In diesem Geheimnis wird die Natur von der Übernatur nicht nur von ihren natürlichen Unvollkommenheiten gereinigt und mit der außerwesentlichen Beschaffenheit der Gnade ausgestattet. Die menschliche Natur hört in der hypostatischen Union auf, sich selbst zu besitzen. Sie hat kein eigenes Sein und keine Person mehr. Sie wird nun von einem Subjekt getragen, einer Person einverleibt, die eigentlich Träger der göttlichen Natur ist. Die menschliche Natur wird hier der Gottheit „eingepflanzt“, sie wird geradezu eine Natur Gottes. Menschliche Natur und Gottheit fließen hier tatsächlich in der Person des Gottmenschen zu einem substantiellen Ganzen, eine alle Einheiten der Natur übertreffenden, ganz exzeptionellen Einheit zusammen.
Im Geheimnis der Fleischwerdung und im wunderbaren gott-menschlichen Gleichgewicht, das die hypostatische Union durchwaltet, findet die Thomistische Analektik ihr letzte Vollendung.
Hier wird deutlich: Der im Gottmenschen seine Krönung erreichende analektische Zirkel zwischen dem Unendlichen und Endlichen, zwischen Gott und Mensch, bildet die Urform aller analektischen Vermittlungen, von der alle weiteren immanenten Vermittlungen abhängig sind. Daraus resultiert dann, dass die vom Gottmenschen herrührende Gottähnlichkeit des Menschen „nicht nur innerhalb seiner selbst vermittelt, sondern auch über ihn hinaus zwischen ihm und der Unendlichkeit Gottes … Die zwischen Gott und Mensch vermittelnde Ähnlichkeit ist dieselbe, die innerhalb des Menschen Wesenheit und Existenz, Körper und Seele, In-Sein und Hin-Sein, Natur und Gnade, Freiheit und Notwendigkeit einander vermittelt und proportioniert, um diese innere Ähnlichkeit der Proportion auf sie selbst als äußere zu gründen. Diese ‚transzendierende’ Ähnlichkeit geht jeder ‚immanenten’ ursächlich voraus … Die transzendente Ähnlichkeit enthüllt sich damit als das ursprüngliche Ganze, das jenen abgestimmten assimilierten Teilen (Wesenheit – Sein usw.) immer schon zugrunde liegt.“
So enthüllt sich an dieser Stelle auch der tiefe Sinn eines immer wieder von Papst Johannes Paul II. (z.B. Fides et Ratio, 12) zitierten Satzes aus der Pastoralkonstitution Gaudium et spes des Zweiten Vatikanischen Konzils (22):
„Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf.“
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.


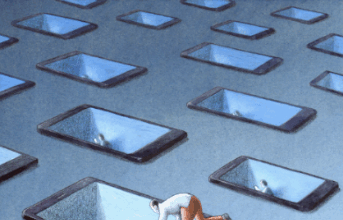






Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.