
I
Sascha und ich wurden ungefähr zu gleichen Zeit munter. Mein erster Blick galt dem Rad. Es stand noch da. Die kleine rote Regenhülle aus Gore-Tex, die ich gestern irgendwo weit oben auf der Weide gefunden, mitgenommen und zum Schutz vor dem Regen über den Ledersattel gezogen hatte, leuchtete in der Morgensonne. Ich entriegelte die Tür, so dass Sascha aussteigen konnte, und Sascha öffnete die Heckklappe, damit ich heraus konnte. Draußen war schönes Wetter, 19 Grad, heiter. Andere Leute frühstückten bereits. Jemand rasierte sich im Auto. Auch am Bächlein war Betrieb. Eine Alte in einem traditionellen Kleid aus dunkelgrüner, goldbestickter Seide, mit Tüchern und einem Kopftuch, trug einen Kanister zum Graben. Frauen saßen auf der Wulst an seinem Rand und hielten Morgentoilette. Junge Mädchen machten ihnen die Haare, man wusch und schminkte sich gegenseitig. Ein sehr friedliches Bild. Aus den zwei Zelten waren vier geworden. Dann sah ich es: Wir waren nicht mehr an Position dreißig. Mehrere bis auf das Dach schwer bepackte Geländewagen hatten sich ganz vor in die zweite Reihe – das heißt: auf die Kiespiste neben der Straße – gestellt. Gerade kam wieder ein Auto angebraust, umfuhr vorn die Warteschlange und reihte sich seitlich daneben an einer der ersten Positionen ein. Hier galt offenbar, wer zuletzt kommt, mahlt zuerst. Dieser „Krieg um die Positionen“ musste schon in der Nacht begonnen haben.

Die Biker packten ihre Zelte zusammen und fuhren dann ebenfalls bis direkt vors Eisentor der Grenzstation. Das ärgerte nicht nur mich, sondern auch die Leute, die sich ebenfalls seit gestern oder noch länger brav angestellt hatten. Da ich die Gepflogenheiten hier nicht kannte, versuchte ich zunächst, die Situation zu akzeptieren. Vielleicht handelte es sich ja um Diplomaten, die das Recht zum Vordrängeln besaßen? Ich brauchte nicht lange um zu erkennen, dass dem nicht so war, sondern es sich allein um Respekt- und Rücksichtslosigkeit handelte. Hinter mir stand ein Russe mit einem Gazelle-Kleintransporter. Diese, und die härteren, geländegängigeren UAZ waren hier, wie in ganz Russland, häufig anzutreffen. Mit ihm – er war sehr freundlich zu mir – unterhielt ich mich darüber. Er schüttelte den Kopf und meinte: „Kasachi – Kulturyj njetu“ (Kasachen – keine Kultur). Tatsächlich waren es fast ausschließlich Mongolen und Kasachen, die sich vordrängelten.
Auch das Auto vor uns, ein SsangYong, war kasachisch. Die Familie schien nett, man nickte uns einen Guten Morgen zu. Der Umstand, dass man gemeinsam hier wartete, gemeinsam auf der Straße seinen Morgenkaffe (ich) bzw. seinen Morgentee (sie) kochte und gemeinsam von den Dränglern um wertvolle Zeit betrogen wurde, stiftete Verbindung. Zwei von dieser Familie – junge Menschen Anfang zwanzig – schienen an einer Unterhaltung nicht uninteressiert. Sie scharwenzelten immer in der Nähe herum. Blicke wurden ausgetauscht, ein Lächeln. Ich sprach sie an. Es waren Bruder und Schwester, Amanjo und Arai. Die Familie kam aus der Hauptstadt Astana (01 am Kennzeichen). Beide studierten, die Schwester sprach aber besser Englisch. Ich fragte sie, weshalb so viele Kasachen in die Mongolei fahren würden. Kasachen seien über mehrere Ländern verstreut, antwortete sie. Auch im Westen der Mongolei lebten viele Kasachen. Man würde eben die Verwandtschaft besuchen. Ich zeigte ihr das gestern gepflückte „herrliche Kraut“. „Weißt du, wie das heißt?“
Die Schwester besah es sich, drehte das Stänglein zwischen den Fingern und sagte dann, „Ich kenne das. Das wächst hier überall. Ich glaube, man nennt es Schusan.“ Ich hielt ihr mein Notizbuch hin. „Bitte, schreibe es.“ In feiner, weiblicher, kyrillischer Handschrift schrieb sie:
Жусан
So konnte ich mit ihrer Hilfe zu Hause herausfinden, dass es sich um eine der unzähligen Arten von Artemisia handelte, genauer gesagt wahrscheinlich um eine Unterart von Wermut, der wohl aufgrund der Bitterstoffe nur von Kamelen gefressen wird.
Um 8:10 Uhr, fast eine Stunde eher, als gedacht, öffnete die Grenze. Die ersten fünf Autos wurden durch das Tor gewunken. Dann verschloss man es wieder. Leider konnten wir nur wenige Meter vorrücken, weil von hinten erneut ein Wagen in viel zu hohem Tempo vorbeizog und sich vordrängelte. Jetzt reichte es mir. Als der nächste Drängler vorbei wollte, stellte ich mich mitten auf die freie Spur und blockierte sie. Mit einer strengen Armbewegung zeigte ich nach hinten, wo er hergekommen war: fahr zurück! Einige Minuten standen wir uns Aug‘ in Auge gegen über. Dann gab er auf und legte den Rückwärtsgang ein. Die Umstehenden sahen, dass das funkzanierte. Von nun an gelang es kaum noch jemandem, sich an die Spitze zu setzen. Auch Russen und Kasachen traten nun in die Straße und ließen keinen mehr durch.
Sascha kamen wieder Zweifel, ob sie mit dem Ausweis über die Grenze konnte. Sie fragte einen anderen Mann. Der meinte, man brauche einen Reisepass. Ausweis genüge nicht. Nun saßen wir nebeneinander im Auto und waren hin- und hergerissen. Sollte Sascha nicht über die Grenze dürfen, brauchten wir uns auch nicht anzustellen. Denn ohne sie wollte ich nicht in die Mongolei. Ich sagte ihr, sie könne nur eines tun: einen Grenzbeamten fragen. Sascha zog ihre Papiere heraus und sah gedankenverloren auf den Ausweis. „Hast du nichts anderes dabei?“ fragte ich.
„Das hier“, meinte sie.
„Was ist das?“
„Mein Gesundheitspass“, entgegnete sie und hielt mir ein Dokument mit einem Foto und ihrem Namen hin. Ihr Name…
Aleksandra Wladimirowna Syromjatnikowa…
Ich sah ihren Namen! Ein Moment, als würde der Vorhang vor dem Allerheiligsten gelüftet. Ihr Vater hatte also Wladimir gehießen. Augenblicklich wurde er für mich zu einem realen Menschen. Hatte sie ihn sehr geliebt? War dies eine weiteres Bruchstück des großen Rätsels namens Sascha? Ich sprach ihren Namen leise aus. Da begriff sie, was sie getan hatte, riss mir das Dokument aus der Hand und schimpfte „Oh, du hast meinen Namen gesehen!“
„Ja“, grinste ich. „Endlich weiß ich, wie du heißt. Vielen Dank. Und ich werde deinen Namen nie wieder vergessen.“
„Wirst du doch!“
„Oh nein, werde ich nicht. Ich werde ihn mir gleich aufschreiben. Aleksandra. Wladimiowna. Syromjatnikowa.“
„Wirst du nicht! Ich erlaube es nicht!“
„Ha! Du hast mir gar nichts zu verbieten.“ Ich griff zu Stift und Zettel.
Sascha riss mir beides aus der Hand. Okay, so wurde das nichts. Ich beschloss zu warten, bis sie sich beruhigt hätte.
„Warum soll ich denn deinen Namen nicht wissen?“
„Er ist nicht so wichtig. Es ist besser, wenn ihn niemand kennt.“
„Aber wieso? Hast du was verbrochen?“
Sascha sah mich an, als ob ich komplett bescheuert wäre.
„Ich bin einfach nicht so wichtig.“
„Mir schon …“
„Zeig mir deinen Pass!“ befahl sie.
Ich ließ es geschehen. Alles, nur dass sie sich wieder beruhigte. Sie machte eine Bemerkung über mein Foto, las dann meinen Namen laut und fragte: „Ist das ein deutscher Name? Ich dachte das wäre italienisch?“
„Ja, ursprünglich schon. Aber ich werde mit K geschrieben. Damit ist es nicht mehr italienisch“ (sondern die slawische Form. Aber das sagte ich nicht. Es hatte mir gefallen, als ich herausgefunden hatte, dass Marko mit k tatsächlich die slawische Schreibweise war. In Russland kam mir jede persönliche Verbindung zum Slawischen gelegen).
„Ich kenne nur fünf deutsche Namen: Till, Rit-schard, Oliver, Paul und Kchriz-toph.“ Sie tat sich ein wenig schwer mit der Aussprache.
„Wieso gerade diese fünf?“
„Das ist die Band, die Mitglieder von Rammstein.“
Nein, war das süß. Wie ein verliebter Teenie. Mein Herz schlug für das Mädchen und der Gedanke, dass sie möglicherweise nicht über die Grenze durfte, tat mir weh. Nebenbei sprach ich leise immer wieder ihren Namen vor mich hin, um ihn auswendig zu lernen: Aleksandra Wladimirowna Syromjatnikowa. Nach ein paar Minuten gab ich vor, mir einige Notizen machen zu wollen, und schrieb, mit der Hand abgedeckt, ihren Namen auf. Sie sah es, als es zu spät war. Zunächst wütend – „Ich wusste es doch!“ – schien sie es mir doch bald zu verzeihen und akzeptierte, dass der Mensch, mit dem sie nun schon den fünften Tag unterwegs war, mit dem sie von Kilometerschild 37 in Berdsk bis Kilometerschild 943, das direkt vor der Grenze stand, inklusive zweier Abstecher von je etwa 40 km, bis heute knapp 1000 Kilometer gefahren war – dass dieser Mensch jetzt ihren Namen kannte. Wie hatte sie mir gesagt: sie versuche die Dinge so zu nehmen, wie sie kämen, ohne sich allzu arg darüber aufzuregen. So verfuhr sie nun auch; der „Vorfall“ wurde nicht wieder erwähnt.
II
Ihre nächste Gelegenheit, Enttäuschendes mit stoischer Gelassenheit wegzulächeln, folgte schon kurz darauf. Am geschlossenen Eisentor bestätigte uns ein Grenzer, dass Sascha mit ihrem Ausweis die Grenze nicht passieren könne. Diskussion sinnlos. Für mich hingegen ging es auch ohne Visum. Es traf uns beide trotz allem unvorbereitet. Die staatliche Eisdusche, der Hammer der hohen Instanz, das Ende aller Phantastereien von grenzenloser Freiheit und gemeinsamem Herumziehen. Sollte sich Sascha tatsächlich gewünscht haben, mit mir in die Mongolei zu kommen, war dies, nach den Seen, den Wasserfällen und der Belucha schon der vierte Traum, der ihr genommen wurde. Wir mussten eine Entscheidung fällen: sollten wir gemeinsam kehrt machen oder würde Sascha aussteigen und ich allein weiter fahren? Mir gefiel beides nicht. Doch ich wollte so gern diesen Stempel im Pass. Ich wollte in der Mongolei gewesen sein. So versuchte ich es wieder mit einem Vorschlag:
„Gestern habe ich von da oben aus die andere Seite der Grenze beobachtet. Da war kein einziges Auto. Ich denke, wenn ich nur kurz reinfahre und gleich wieder heraus, könnte ich noch heute Nachmittag wieder da sein. Wenn du ein paar Stunden wartest. Dann könnten wir zusammen zurück fahren. Wohin du willst.“
Sie sah mich an. Dieser Blick …
„Oder sollen wir gleich umkehren? Ich meine, so etwas Besonderes ist es ja vielleicht gar nicht.“
Sie lächelte, schüttelte den Kopf, öffnete sie die Heckklappe und holte wortlos ihre Reisetasche heraus.
„Ich werde warten“, sagte sie. „Du bist so weit gefahren. Ich weiß, dass du in die Mongolei willst.“
„Ich verspreche dir: ich komme heute noch wieder, spätestens morgen Vormittag. Okay? Wartest du wirklich?“
„Ich werde warten.“
„Wo? Wo finde ich dich?“
„Ich brauche Schatten. Hier gibt es keine Bäume. Ich werde irgendwo in einem Kafe sitzen.“
„Okay.“
Sascha warf ihren Rücksack über, nahm die Reisetasche in die Hand und ging Richtung Wiese. Die Warteschlange rückte auf; keine Zeit mehr, mit Sascha zu reden. Es wurde hektisch. Ich musste acht geben, dass keiner in die Lücke vor mir stieß. So schnell ging das also. Ein plötzlicher Einschnitt und wir waren nicht mehr zusammen unterwegs. Sascha wanderte quer über die Wiese. Was mich wunderte, da ich erwartet hatte, sie würde, um Schatten zu suchen, nach Taschanta gehen. Egal. Ich musste jetzt konzentriert bleiben. Es ging nun doch relativ zügig vorwärts. Alle viertel Stunde fünf bis sieben Autos. Leider kamen auch jetzt immer noch irgendwelche Idioten von hinten angefahren, die glaubten, sich alles erlauben zu können und sich vordrängelten.
Bei all dem hatte ich keinen Frieden. Wegen Sascha. Wegen Aleksandra Wladimirowna Syromjatnikowa. Was es auch gewesen sein mochte – ob Furcht vor dem Allein Sein, ob die Sorge, sie ungerecht behandelt zu haben oder gar Angst, sie zu verlieren – es wurde stärker und stärker. Ich hielt Ausschau nach ihr, suchte sie unablässig mit dem Auge. Wenn ich sie doch wenigstens gesehen hätte, wenn ich gesehen hätte, dass sie glücklich ist. Dass sie vielleicht mit jemandem zusammen saß und sich unterhielt. Da erspähte ich sie. Das war sie. Ein einsamer roter Punkt zog langsam die Steppe hinauf. Die Piste entlang, die neben dem Gatter verlief. Sascha hatte schon mehrere hundert Meter zurück gelegt. Ich sah ihr mit dem Fernglas nach. Im typischen Gang, nach vorn gebeugt, als trüge sie eine schicksalhafte Last und nicht nur ihren Rucksack, mit langsamen, leicht schlurfenden Schritten, wanderte sie in die unendliche Einöde der Steppe hinaus, dorthin, wo gar nichts war. Und laut Karte auch nichts mehr kommen würde. Abgesehen von Indien, in 2000 Kilometern Luftlinie, falls sie den Tienshan, die Wüste Taklamakan und das Karakorum-Gebirge in ihren Trekkingsandalen und ohne Pullover heil bezwingen würde. Da verließ mich die Beherrschung. Ich wusste plötzlich nur noch eines: Ich wollte gar nicht mehr in die Mongolei. Ich wollte mit Sascha weiter fahren. Wollte nicht das Bild dieses irgendwie traurigen, starken, verschlossenen Mädchens mit ansehen müssen. Wollte mich nicht in ihre Verlassenheit hineindenken müssen. Wollte nicht dafür verantwortlich sein, dass ihre Träume zerplatzten. Ich stieg aus und rief ihren Namen. Ich pfiff. Alle um mich herum bekamen es mit. Zumindest diejenigen, die in den Pausen ausgestiegen waren. Ich hielt die Hände an den Mund, formte einen Trichter und pfiff noch einmal so laut ich konnte. Es war mir egal, was die Leute dachten.
Sascha war bereits zu weit weg. Ich beschloss, das Abenteuer Mongolei abzubrechen, startete den Motor, zog heraus, wendete, fuhr zurück und parkte den Bus im Schatten eines Hauses, gleich neben der Straße – hoffend, dass kein Kipplaster hier rangieren und mir keiner einen Spiegel abfahren oder etwas noch Schlimmeres geschehen würde. Dann lief ich Sascha hinterher. Doch entweder ich war nicht mehr so fit wie früher, oder aber es war die Hitze oder die Höhe oder alles zusammen – die Strecke bis zu ihr wurde zu einer unglaubliche Tortur. Mit meinem schlabberigen Flip-Flops hastete ich im leichten Joggingtempo, meine Lungen, meine Beine, alles schmerzte und brannte wie Feuer und vor Schwäche. „Sascha!“ rief ich. Aber sie hörte nicht. „Sascha!“ Nie werde ich das Bild vergessen, wie der rote Rucksack einfach weiter ging. Ich blieb stehen und pfiff. Ich konnte sehr laut pfeifen. Nichts. Unbeirrt schritt sie weiter und weiter aus, dahin, wo keine Menschenseele sein würde: In die vollkommene Einsamkeit der Steppe. Ich rannte, noch einmal hundert Meter. Jetzt musste sie mich doch hören! „Sascha!“ Dieser Kilometer fühlte sich an wie zehn. Ich brüllte mit aller Kraft: „Eeeeeeey!!!!!“ Sie wandte sich um. Ich winkte wie ein Ertrinkender und lief, mal joggend, mal gehend, völlig außer Atem, die Piste hinauf. Da machte sie wieder kehrt. Wollte sie ernsthaft weiter gehen? „Sascha! Please! Waaaait!“ Endlich gab sie nach und wartete, bis ich sie erreicht hatte.
„Ich will nicht in die Mongolei“, japste ich vollkommen erschöpft. „Ich will nicht ohne dich dorthin fahren. Ich will dich nicht hier zurück lassen. Wenn du willst – wir können wieder fahren.“
Mein Kopf dröhnte, ich hatte dieses kribbelnde Flirren in den Zähnen, das ich nur bei äußerster Anstrengung empfand.
„Du vertraust mir nicht, stimmt’s? Du denkst, ich würde nicht auf dich warten.“
„Ich fände es einfach schade, wenn man sich verlieren würde.“
Sie lächelte.
„Ich habe es dir doch gesagt: ich werde bis morgen warten. Du wirst mich sitzen sehen. Vielleicht am Straßenrand, vielleicht in einem Kafe.“
„Aber das ist mir egal! Ich will gar nicht mehr in die Mongolei …“
Sascha stand am Hang, über mir und sah mich ernst an:
„Doch. Du fährst in die Mongolei. Du musst in die Mongolei fahren, hörst du? Du bist soweit gekommen. Ich weiß genau, dass du es für immer bereuen würdest, wenn du jetzt nicht in die Mongolei fährst. Du musst das tun, ja? Ich werde warten.“
Sie sprach mit Autorität. Woher nahm sie diese nur? Als hätte mir ein Priester Absolution erteilt, stellte sich eine ungeheuere Erleichterung, ja geradezu eine Befreiung, ein. Alle Zweifel, ob es richtig wäre, fielen ab. Ich sagte: „Okay, Sascha. Danke.“ Dann lief ich zurück. Vom Auto aus war sie kaum noch zu erkennen. Ich verfolgte den roten Rucksack, bis er hinter dem Hügel verschwand.
III
Sascha war weg. Ich musste mich konzentrieren, musste nach vorn schauen. Was in meiner Situation zunächst bedeutete, wieder an meine alte Position zu kommen. Die Schlange reichte bis weit nach Taschanta hinunter – einhundert Autos vielleicht – und ich hatte keine Lust, mich ganz hinten anzustellen. Damit wäre das ganze Unterfangen „Stempel im Pass“ sinnlos geworden, denn ich glaubte nicht, dass heute so viele Autos abgefertigt würden. Die Grenze sollte angeblich um 18 Uhr schließen. Wenn überhaupt, wäre ich erst am späten Abend in der Mongolei. Also blieb mir nur eines… Nun war ich derjenige, der einfach vorfuhr. Die Leute jedoch, die das Drama mitverfolgt hatten, ließen mich ohne zu Murren wieder in meine alte Position einscheren. Kaum war das vollbracht, klopfte ein junger Mann ans Fenster. Ob ich ihn mit nehmen könne, nur bis über die Grenze. Er habe gesehen, dass bei mir ein Platz frei geworden sei… Ja aber sicher doch, immer herein spaziert!

Er stellte sich als Ivan Popov, freier Webdesigner aus der Nähe von Moskau, vor, auf dem Weg nach Thailand. Vatersname: Konstantinowitsch. Unterwegs per Abto Ctop. Arbeiten könne er überall, da er nicht viel mehr brauche, als hin und wieder einen Internetzugang. Sein nächstes Ziel sei Ulaan-Bator. Ivan sprach einwandfreies Englisch, war 24 Jahre alt, jungenhaft, schlank, mittelgroß, blond, blauäugig, ordentlich frisiert, Dreitagebart, trug ein hellblaues T-Shirt zur anthrazitfarbenen Soft-Shell-Hose und hatte einen entwaffnend freundlichen Gesichtsausdruck vom Typ „Schwiegermutters Traum“. Ich war nicht allein! Wunderbar!
Ivan war ganz anders als Sascha. Ihn er trug nicht an einer schweren Last. Ihn umwogte kein Geheimnis. Die Welt schien ihm kein Gegner, kein Berg, den er bezwingen, sondern der beste Kumpel und eine Woge zu sein, auf der er surfte. Als ich ihn fragte, wie er durchs Land käme, meinte er denn auch, per Couchsurfing. Ich solle das auch versuchen. Könne sogar bei ihm zu Hause unterkommen. Und er nannte mir seine Adresse.
Ivan wurde mir eine große Hilfe. In der Grenzstation dolmetschte er, erklärte mir, welchen Zettel ich wie ausfüllen musste und worum es an welchem Schalter ging. Die russischen Grenzbeamten arbeiteten zügig, sachlich, korrekt und nicht schikanös. Kurz nach Zehn Uhr kamen wir dran. Unsere Identität wurde aufgenommen, am Таможня musste ich die Zollerklärung ausfüllen und mein Auto wurde inspiziert. Wie beim lettisch-russischen Grenzübertritt zog meine grüne Armeekiste die Aufmerksamkeit auf sich. Doch der Inhalt beruhigte die Gemüter. Was der Grund meiner Reise sei? Wieder wurde ich zum Journalisten aus Deutschland, der eine „positive Reportage“ über Russland schreiben wolle. Nach anderthalb Stunden waren wir durch.
Ich blätterte in meinem Pass auf der Suche nach dem mongolischen Stempel, fand aber keinen. Seltsam. Vielleicht gab es nur einen russischen? Ein Grenzer öffnete uns das Eisentor auf der anderen Seite – die Grenzstation spuckte uns aus: ins Niemandsland. Hier konnte Ivan nicht aussteigen. Hier gab es ja nichts. Also fuhren wir erst mal weiter. Laut Karte ging es ein paar Kilometer bergauf, über einen Pass und drüben wieder hinunter. Ich wollte bis zum ersten Anzeichen menschlichen Lebens in der Mongolei fahren. Die Straße hoch zum Pass war zweispurig, schmal, hatte einen groben Asphalt, weiße Mittel- und gelbe Seitenstreifen. Wir fuhren ganz allein durch die Steppendünen, Kurve um Kurve, immer bergauf. Und unterhielten uns gut dabei. Mit ihm zu fahren war etwas völlig anderes, als mit Sima oder Sascha. Ivan besaß eine hohe soziale Intelligenz, war gebildet, locker, rücksichtsvoll, offen und umgänglich. Er wusste ein Gespräch zu führen, ging auf den anderen ein, war interessiert, fragte nach – genau die richtigen Fragen – und seine Wesensart beanspruchte weder zuviel Raum, noch machte sie sich unnötig klein. Er schien sehr geübt darin, schnell mit neuen Menschen zurechtzukommen, flexibel und anpassungsfähig zu bleiben. In einem Wort: Ivan war der perfekte Begleiter. Die reinste Freude.
Nach 14 Kilometern erreichten wir unter flirrender Hitze den Pass in 2481 m Höhe. Doch was war das? Links im Gelände stand ein Haus. Weiß mit grünem Dach. Neben der Straße war ein Stahlgerüst, eine Art Tribüne, errichtet. Die Straße selbst führte durch ein rotes, einseitig offenstehende Eisentor. Und da war auch wieder ein Zaun, quer durch die Steppe, kilometerweit. Wir näherten uns langsam. Am Eisentor dann des Rätsels Lösung: МОНГОЛИЯ stand auf einem Schild, unübersehbar, mit mongolischer Flagge. Daneben ein zweites Schild: STOP (in lateinischen Buchstaben). Ich machte schnell zwei Fotos, schon wurden wir durchgewunken. Anscheinend noch einmal Russen. Hier also war erst die eigentliche Grenze. Und ich hatte gedacht, wir wären längst in der Mongolei! Der Asphalt endete am Tor. Es begann eine beinharte Kies- und Schotterpiste. Auf der anderen Seite des Eisentores warteten mehrere Autos und drei vollbepackte Quads.
Okay, dies also war jetzt wirklich die Mongolei. Ich brauchte ein paar Sekunden, um die neue Information gedanklich einzuordnen. Dann war also die andere Seite des Stacheldrahtzauns, Saschas und mein konspiratives Schlüpfen durch den Gang zum Viehtrieb, die Kamleherde an den hinteren Dünen – dann war all das noch russisches Gebiet gewesen! Ich hatte noch keinen Schritt auf mongolischen Boden gesetzt. Verstanden. Es fühlte sich auf jeden Fall gut an, jetzt definitiv in der Mongolei zu sein. Man spürte es, dass dies noch einmal eine ganz andere Welt war. Welche Konsequenz diese Situation mit sich brachte, das freilich hatte immer noch nicht begriffen. Bis zu einer Kurve. Von dort an ging es steil bergab. Wir hatten das rote Eisentor schon zwei, drei Kilometer hinter uns gelassen. Ein Geländewagen überholte mit einem aggressiven Manöver. Weshalb fuhr der so schnell? Lag ihm nichts an seinem Auto? Unten, am Fuße des langen Hanges, standen erneut mehrere Gebäude. Davor wartete eine Autoschlange. Bei mir fiel endlich der Groschen:
„Ivan, weißt du was das ist? Die mongolische Grenze.“
„Ich glaube, du könntest recht haben.“
Wir hatten es noch lange nicht geschafft.
IIII

Das, was anderswo unmittelbar aufeinander folgt, lag hier schlicht und ergreifend 20 Kilometer auseinander. Da ich an der russischen Grenze wenig verstanden hatte, da danach nichts mehr gekommen war und mich ohnehin nur eines interessierte hatte – möglichst schnell in die Mongolei hinein und schnell wieder heraus zu kommen – war mein Wunsch wohl Vater des falschen Gedanken gewesen. Erst jetzt erfasste ich meine wirkliche Lage: hier würde ich zwar den Stempel bekommen, allerdings würde es mir kaum oder nur mit viel Glück gelingen, morgen zur vereinbarten Zeit wieder in Taschanta zu sein. Wir standen in der beißenden Sonne, auf 2300 m Höhe. Am Berghang neben uns grasten ungewöhnliche Tiere (Rinder ?) mit langer Wolle und überhängenden Nasenlippen wie Elche. Ich dachte auch jetzt wieder daran, umzukehren. Doch was hätte ich dann? Das Geld klingeln gehört, am Braten gerochen, aber nichts Konkretes. Keinen Stempel, der alles beweisen würde.
Du musst in die Mongolei fahren, hörst du?
Ja, Sascha.
An der Grenze ging längere Zeit nichts vorwärts. Ohne Ivan wäre es sterbenslangweilig gewesen. Er hörte einer meiner beiden CDs durch, aufmerksam, analytisch, und meinte dann anerkennend: „Mit dieser Musik könntest du viele Menschen glücklich machen. Warum versuchst du es nicht?“
Ich entgegnete, dass dies in meinem Alter und gleich doppelt als mehrfacher Familienvater im Prinzip nicht mehr möglich sei. Als junger Mensch hatte ich noch geglaubt, mit der Musik erfolgreich sein zu können. Und auch dafür gekämpft. Aber das kam mir vor wie eine andere, abgeschlossene Zeit. Nach einer Weile sinnierenden Schweigens bat er mich, ihm diese CD zu schenken. Sehr gern, Ivan Konstantinowitsch Popov. Zu diesem Zweck hatte ich sie ja mitgenommen.
Ein Junge kam und bot mongolisches Geld gegen Rubel an. Ich tausche einen nagelneuen 5000er Schein für 150 Rubel – ein Souvenir. Die Währung hieß Törög (төгрөг) und enthielt neben kyrillischen auch mongolische Buchstaben und Zahlen, mit Nullen die aussehen wie unsere, und einer 5, die dem Tierkreiszeichen für Krebs ähnelt. Auf einer Seite war Dschingis Khan abgebildet. In der Mongolei hatte man kein Problem damit, einen „Diktator“, bei dessen Eroberungen zig Millionen Menschen das Leben gekostet hatte, bis heute zu verehren. So unterschiedlich ging es zu auf der Welt. Am Ende wurde die Goldene Horde des mongolischen Herrschers vom Klima besiegt, weil sich der Kleber ihrer aus Horn gefertigten Reiterbögen in der feuchteren Luft Europas löste.
Vor uns die Leute waren mir schon in Taschanta aufgefallen. Besonders der eine, drahtige alte Mann, von dem ich bereits Fotos gemacht hatte. Komisch: vor der russischen Grenze hatte er sich mit anderen alten Männern unterhalten und ein rundes Käppchen aus dunkelblauem Samt getragen. Alle alten Männer hatten solche Käppchen nach mongolischer oder kasachischer Art auf gehabt. Hier nun trug er ein schneeweiß leuchtendes Schiebermützchen. Zusammen mit einer obercoolen Sonnenbrille sah der Alte jetzt aus wie ein Star auf den Filmfestspielen von Cannes. Ob er in der Mongolei „westlich“ und in Russland „mongolisch“ aussehen wollte? Ich machte ein Foto, stieg dann den Hang hinauf und nahm ein bisschen Wolle jener seltsamen Tiere mit, die dort herumlag. Sie hatte einen kernigen Geruch und war sehr fettig.
Von hinten kamen einige Biker die Piste herunter gefahren. Wieder stellten sie sich rotzfrech ganz vor. Diesmal nicht, Freunde, dachte ich mir, und begab mich auf einen kleinen Spaziergang. Die Biker waren aus Großbritannien (GB), Italien (I) und Litauen (LIT); ich sah auch einen Deutschen in der Warteschlange, in einem alten LandCruiser, aus dem hessischen Vogelsbergkreis (VB). Wieder überkamen mich die alten Hemmungen, mich einem Deutschen als Deutscher erkennen zu geben. Statt dessen sprach ich einen der wartenden Biker auf Englisch an. Ich wollte eine Erklärung, weshalb sie sich immer einfach vordrängelten. Der Mann schob Kinnschutz und Visier nach oben und antwortete mir ganz freundlich, das sei nun einmal so. Tatsächlich würden sie, so behauptete er, von den Grenzbeamten fast überall vorgewunken, weil es bei Bikern weniger zu kontrollieren gäbe. Biker hätten eben eine Sonderrolle. Aber der Papierkram wäre ja wohl der gleiche, erwiderte ich. Und dass sie damit den anderen Wartenden wertvolle Zeit stahlen, das sei ihm wohl egal? Der Mann gab zu, es läge eine gewisse Ungerechtigkeit darin, wenn man es so sähe, wie ich. Was ihn jedoch nicht dazu veranlasste, sich wieder hinten an zu stellen. Ich beschloss, sollte ich je über diese Reise schreiben, das Verhalten der Biker zu erwähnen, so sehr ärgerten mich diese Extrawürste auf Kosten der anderen Reisenden. Kulturyj njetu. Als ich sah, dass diese Diskussion nichts bringen würde, wechselte ich das Thema. Ich wollte nicht den Eindruck des besserwisserischen Deutschen in der Welt hinterlassen. Besonders der Litauer beeindruckte mich. Er war auf einer 125er Cross-Maschine bis hierher gefahren. Ein halbes Moped! Nicht schlecht.
In der Grenzstation wurde es lebendig. Beamte in Uniformen liefen über das Gelände. Ivan und ich beobachteten angespannt, was nun geschehen würde. Das Tor wurde aufgeschlossen. Es ging los. Die erste Amtshandlung eines jungen, großen und schlaksigen mongolischen Grenzers war, die Biker mit einer strengen Geste nach ganz hinten zu verweisen. Mit einer Geste, die klar machte: entweder ihr stellt euch wie jeder an oder ich lasse Euch hier schmoren bis Sonnenuntergang. Was für eine Genugtuung. Ein Mensch mit Gerechtigkeitssinn! Ich stieg aus und applaudierte ihm.
Fünf Autos wurden herein gelassen, etwa zwölf waren noch vor uns. Wir rückten auf bis an eine kleine Hütte, bei dem man für irgendetwas bezahlten sollte. 100 Rubel. Es widerstrebte mir, für etwas, das ich nicht verstand, an Leute außerhalb der Grenzstation, die ganz offensichtlich ärmliche Zivilisten und keine Beamten waren, Geld zu zahlen. Ivan erkundigte sich. Man wollte mein Auto waschen. Ich fand das sinnlos, denn die Piste war staubig. Nein, nein, entgegnete man mir, dadurch würde das Auto von Keimen befreit. Keiner dürfe irgendwelche Erreger aus Russland in die Mongolei einschleppen. Es gab eine flache Betonwanne, in die man hineinfahren musste. Dort wollte ein vielleicht 14-jähriges Mädchen die Räder mit Seifenwasser abspritzen. Den Schriebs, den ich dafür bekäme, müsse ich unbedingt aufbewahren, sonst gäbe es Probleme. Aha. Auf dem Beton neben der Wanne hatte sich in einem ausgebröckelten Loch eine Pfütze gebildet. Zwei Dutzend schwarze Ziegen drängten sich darum und versuchten, daraus zu trinken. Einhundert Rubel (1.60 Euro) waren in meinen Augen reine Abzocke; das klang zwar wenig, aber wenn die hier am Tag 50 Autos „von Keimen befreiten“, würde die Familie (oder wer immer dahinter steckte) bis zum Abend 80 Euro „verdient“ haben. Und das schien mir für ein solch armes Land dann doch ungebührlich viel. Trotzdem dachte ich, als wir dran waren, drauf geschissen, bevor die irgendwelche Dinger mit dir drehen und jemandem auf der anderen Seite die Kennzeichen von den Autos durchgeben, der keinen „Nachweis“ auf Keimfreiheit erbringen können, lässt du es halt über dich ergehen.
Ich gab also dem Mädchen 100 Rubel. Worauf sie einen vorgedruckten Zettel von einem Block riss, ihn unterschrieb, mir aushändigte – und nichts weiter tat. Und? Was ist jetzt mit der Reinigung, gestikulierte ich. Sie eierte ein bisschen herum, dann stellte sich heraus, dass das Kärchergerät nicht ansprang; der Kompressor sei kaputt. Kann nicht wahr sein, dachte ich, und verlangte, dass sie mein Auto auf der Stelle „keimfrei“ machte. Nun wurde sie ganz kleinlaut, mühte sich am Kompressor ab, holte einen Onkel oder wen auch immer, der sich das Teil ansah, ein bisschen daran rüttelte, und dann erstaunt von unten hochschaute – frei nach dem Motto: ups, da jeht ja wirklich nüscht – als hätte er das nicht schon längst gewusst. Bis vor kurzem war hier scheinbar tatsächlich noch gewaschen worden. Hmm, machte ich zu dem Mädchen, das sei irgendwie ungünstig. Wie soll denn jetzt mein Auto von Keimen befreit werden? Wie soll ich denn so in die Mongolei fahren? Wieso würde sie ihr Wort nicht halten? Schließlich hätten wir eine Vereinbarung getroffen: ich zahle 100 Rubel und sie reinigt dafür mein Auto. Da mein Auto nicht gereinigt werden könne, bestünde ich darauf, meine 100 Rubel zurück zu bekommen und streckte ihr meine Hand entgegen. Das Mädchen wollte nicht. Okay, sagte ich, das wasche bitte mein Auto. Das konnte sie nicht. Wieder streckte ich ihr meine Hand hin. Das Mädchen sah ein, dass sie geschlagen war, griff betreten in ihre Schürze und gab mir meinen Geldschein zurück. Den Zettel aber, der bestätigte, dass mein Auto keimfrei sei, behielt ich. Man konnte ja nie wissen.
Gegen 13:30 Uhr wurden wir eingelassen. Ohne Ivan wäre ich hier hoffnungslos abgesoffen. Man ist so hilflos wie ein Baby wenn man das zum ersten Mal mitmacht, weil man überhaupt nicht versteht, was jemand, der oft nur rudimentär Russisch und gar kein Englisch spricht, von einem will. Die russischen Grenzbeamten sprachen wenigstens fließend Russisch und wussten sogar ein paar Worte auf Englisch. Grundsätzlich lief es hier zwar ähnlich. Praktisch jedoch war alles viel komplizierter – nicht nur der Sprache wegen. Auch die bürokratische Erfassung war umständlicher und um Jahrzehnte zurück. An einem Anmeldehäuschen vor dem eigentlichen Grenztor – und man war heilfroh, wenn man es bis dahin endlich geschafft hatte, denn das bedeutete, dass der Prozess nun definitiv begann – an diesem Anmeldehäuschen also musste man zunächst seinen Pass und die Zulassung des Autos herzeigen. Dort wurden die Daten handschriftlich erfasst; der erste Beamte reichte dann ein Zettelchen mit meinem Kennzeichen an einen zweiten, der die darauf vermerkten Daten in einen Computer eingab, eine Zeile des Zettelchens handschriftlich ausfüllte, abriss und mir aushändigte. Ich nahm an, dass ich es gut aufbewahren sollte. Mit dem Zettelchen ging man zurück zu seinem Auto und wartete wieder bis einem das Tor geöffnet wurde und man einfahren durfte. Im Inneren der Grenzstation ging es mit Pass und Zulassung zur Passkontrolle. Und zwar nicht gesittet, sondern wer zuerst kommt mahlt zuerst. Sprich: die Einheimischen stürzten an die Schalter, jeder wollte möglichst weit vorn in der Schlange stehen, selbst beim Anstehen wurde noch versucht, sich mehr oder weniger unbemerkt vorzudrängeln. An der Passkontrolle bekam ich meinen Stempel, der bestätigte, dass ich in der Mongolei gewesen war. Die Zulassung wollten sie auch wieder sehen; die Fahrzeugdaten wurden erneut aufgenommen. Ich erhielt ein zweites Zettelchen, mit dem ich zu einem Kontrolleur musste, der sich mein Auto ansah. Wieder mussten wir warten, bis dieser Zeit hatte. Nach erfolgter Kontrolle stempelte er das Zettelchen ab, woraufhin ich dieses im Gebäude am Schalter wieder vorzeigen musste. Natürlich bedeuteten diese Aktion erneut Schlange stehen. Nun dachten Ivan und ich, wir seien durch, da unsere Pässe ja bereits gestempelt worden waren und fuhren Richtung Ausgangstor, weil uns jemand dies so angezeigt hatte. Am Tor jedoch wurden wir abgewiesen. Im herben Befehlston schickte man uns wieder zurück. Ich nahm an, es könne sich nur um ein Missverständnis handeln. Gott sei Dank bekam Ivan heraus, dass uns noch ein letzter Stempel auf dem zweiten Zettelchen fehlte: der vom Veterinär-Beamten. Wieder standen wir Schlange am Schalter. Als wir auch diesen Stempel hatten, war es vollbracht: wir durften wir einreisen. Nicht jedoch, bevor ich das am Einlasshäuschen erhaltene Zettelchen an einem entsprechenden Auslasshäuschen wieder abgegeben hatte – was nochmaliges Auto Abstellen, Aussteigen, Hingehen, Anstellen, Zurückgehen und wieder Warten bedeutete. Welche Meinung musste ein Land von sich selbst haben, wenn es einen Grenzübertritt in solch ein Drama verwandelte. Sieben Wochen später fielen in Deutschland alle Grenzen, was diese Erfahrung für mich im Rückblick besonders eindrücklich macht.
Das Eisentor wurde uns geöffnet. Von jenem sympathischen Grenzer, der die Biker zurück geschickt hatte. Als ich den Moment des Einfahrens in die Mongolei auf Foto festhielt stoppte er uns augenblicklich und verlangte in all seiner staatlichen Autorität, dieses wieder zu löschen. (Wie bei Sims war mir aber ein zweites gelungen, das er nicht gesehen hatte.) Hinter uns schloss er eigenhändig das Tor. Sieben Stunden nachdem am Morgen die Grenzstation in Taschanta geöffnet hatte, war ich endgültig in der Mongolei. Oh Sascha, wenn ich das geahnt hätte.
Dutzende Autos, alles PKW, keine Reise- oder Linienbusse, warteten und wollten aus dem Land heraus. Langsam fuhren wir sie ab. Unter uns knirschte der Kies. Wie in Taschanta gab es auch hier eine kleine Siedlung, die vom Grenzverkehr lebte. Dort angekommen wollte Ivan die Gunst der Stunde – das heißt den Grenzverkehr – nutzen und sich eine Mitfahrgelegenheit nach Ulaan-Bator suchen. Er bat mich, ihn hier abzusetzen. Ein Mann trat heran und wollte 300 Rubel für irgendein Zertifikat, das ich von ihm erhalten und ohne das ich im Land „Probleme“ bekommen könnte. Ivan übersetzte mir ein letztes Mal. Ich meinte, ich würde nicht weit fahren und heute noch zurück kommen. Da winkte der Mann ab. Ivan fackelte nicht lange, schulterte seinen Rucksack, ich bedankte mich für seine Hilfe, er erwiderte den Dank, wir wünschten uns alles Gute – und weg flitzte er, zu einem armeefarbigen, russischen LKW, der am Rand der Dorfstraße tuckerte. Ich war allein. Und verspürte zu nichts weniger Lust, als mich jetzt gleich wieder in die Schlange der Wartenden einzureihen.
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

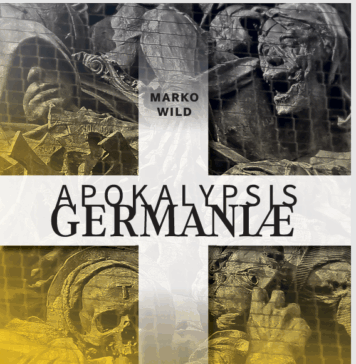







Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.