I
Victor eskortierte mich mit dem Baby-Bike bis zum Konsum. In großem Abstand vor ihm her jagte Berta, wie ein Wolf auf der Hatz, hechelnd, die Zunge seitlich aus den geöffneten Fängen heraus, durch den Staub der Morgenwärme, den kaputten Asphalt der schmalen Straße entlang, immer hart an den windschiefen Bretter- und Wellblechzäunen entlang, hinter denen arme Menschen in ebenso windschiefen Bretterbuden mit Wellblechdächern lebten.
Im Konsum kaufte Victor mir Wurst, Brot, Käse und Butter für die Reise. Es war gute Butter. Victor wusste, welche wirklich nach Butter schmeckte: die Sorte für 72 Rubel das Stück zu 180 Gramm
Dann verabschiedeten wir uns.
„Wie lange wirst du unterwegs sein?“, fragte er.
„Ich weiß es noch nicht. Eine Woche bis zehn Tage.“
„Dann kommst du wieder zu mir.“
„Ja, ich komme zurück.“
„Gute Reise!“
Als ich losfuhr, ließ ich das Fenster noch einmal herunter, klopfte mit dem Arm an die weiße Seite meines Busses und rief Victor zu:
„Schau her! Das ist mein Schiff!“
„Ich weiß!“, rief er mir hinterher, und wurde zu einem einzigen Lächeln. Berta bellte.
Es ging los.
Altai, ich komme!
Alles da vorn war unbekannt. Und alles da hinten in Ordnung. Es gibt keinen besseren Zustand. Am Morgen dieses 12. Juli machte Gott mir ein Geschenk. Ich war noch keine Stunde aus Nowosibirsk heraus gefahren, erwartungsfroh, gelöst und durchlässig wie junges Laubwerk, da stand in der Stadt Berdsk, gleich nach dem breiten Fluss, in einer Kurve, vor einer die Straße überquerenden Brücke, zwischen den rot-weißen Leitbaken einer Baustelle eine Anhalterin und hielt den Daumen raus. Ziemlich jung, mit langen dunkelblonden Haaren, die zu Dreadlocks oder etwas ähnlichem frisiert waren. Genau konnte ich es nicht erkennen. Auf dem Boden neben ihr lehnte ein Rucksack an einer Reisetasche. Ich kannte diesen Typus sehr gut: das war ich – vor einem halben Leben.
Im ersten Moment hielt ich sie für eine Studentin, die nach Hause wollte. Doch hier war bereits die Stadt. Und da sie nicht auf Nahverkehrsmittel, etwa den Bus setzte, trotzdem aber an der Fernstraße wartete, hatte sie entweder kein Geld oder – mein zweiter Gedanke – sie wollte möglicherweise sehr weit weg. Dorthin, wohin die M52 führte: in die einzige überhaupt mögliche Richtung, nach Süden, in den Altai. Außerdem schien sie gerüstet für einen längeren Trip. Nicht wie für einen Besuch in der Stadt.
Ich fuhr an ihr vorbei, unter der Brücke durch und wurde langsamer. Das Mädchen ging mir nicht aus dem Kopf. Was, wenn sie noch lange warten müsste? Was, wenn sie schon lange dort stand und alle – wie ich – nur vorbei fuhren? Ich wollte etwas für sie tun und sprach ein kurzes Gebet: bitte lass jemanden kommen, der sie mitnimmt. Augenblicklich verspürte ich einen inneren Aufruhr. Wieso sollte jemand anders sie mitnehmen? Du kannst sie doch mitnehmen! Schon wechselte mein Fuß auf die Bremse, ging der Blick in den Rückspiegel, schon wendete ich und fürchtete, dass sie in der Zwischenzeit von jemandem mitgenommen worden sein könnte. Hoffentlich nicht! Ich wollte plötzlich, dass sie bei mir mitfährt. Wollte nicht allein fahren. Sah die Chance auf einen Weggefährten. Die Wahrheit war: ich fuhr ziemlich eilig zurück, um zu verhindern, dass jemand anders sie mir wegschnappte.
Sie stand noch da, genauso verloren Ausschau haltend wie vor dreißig Sekunden. Ich wendete erneut, hielt neben ihr und stieg aus. Für sie war ich von Rechts gekommen und wollte sie wieder nach Rechts mitnehmen. Sie also quasi abholen. Das musste ihr seltsam erscheinen. Und so sah sie auch aus, obgleich sie ihre Verwunderung einigermaßen verbarg. Einen Moment lang wurde mir Bange, sie könnte ablehnen. Da spürte ich mit ganzer Wucht, dass ich mir nichts so sehr wünschte und nichts so sehr brauchte, wie menschliche Begleitung. Ich öffnete die Heckklappe und stellte mich auf Russisch als Deutschen vor. Kopfschüttelnd akzeptierte sie.
Es waren keine Dreadlocks. Sie hatte ihr Haar zu vielen dünnen und noch dünneren Zöpfchen geflochten, die ihr fast bis zur Hüfte hinunter fielen. Zwischen den streng gefassten Haarbündeln schaute die Kopfhaut durch. Die Enden der Zöpfe waren mit unterschiedlich farbigen Gummibändchen fixiert. Ein bisschen erinnerte sie mit dieser Frisur an die schlangenhaarige Medusa. Davon abgesehen schien sie keinen besonderen Wert auf ihr Äußeres zu legen. Sie war – ungewöhnlich für eine Russin in der Stadt – weder geschminkt, noch trug sie irgendwelchen Schmuck. Sie hatte eine unruhig gemusterte Leggin aus Baumwolle an (später würde sie mir einmal einen „Vortrag“ darüber halten, dass für sie ausschließlich Baumwolle als Material für unterwegs in Frage käme) und ein weites, langärmeliges, türkisblaues Kapuzen-Shirt aus dem gleichen, dünnen Stoff. Das Ganze sah nicht besonders vorteilhaft aus. Im Gegenteil – es wirkte, als wolle sie möglichst wenig Aufmerksameit auf sich ziehen. Ihre blassen Füße steckten in Trekking-Sandalen. Die großen, grauen Augen schienen auf eine merkwürdige Weise hier und gleichzeitig auf ganz ferne Dinge gerichtet zu sein. Ihr Gesicht war in einem unfertigen Zustand – irgendwo zwischen Baby und erwachsener Frau. Die unauffälligen Züge hätte man gutmütig nennen können, wäre da nicht noch etwas anderes gewesen. Etwas Verschlossenes, eine Spur Härte. Beim Gehen hingen ihr die Arme ohne mitzuschwingen an den Seiten herunter. Ihre Haltung und ihr Gang waren leicht nach vorn gebeugt, die Schritte etwas schlurfend und die Beine leicht x-beinig. Nahezu das Gegenteil einer stolzen, beeindrucken wollenden Erscheinung. Gestikulierte sie, dann häufig mit zurückweisenden, spöttischen Bewegungen, die zum Ausdruck brachten, dass sie eine solche Aufmerksamkeit diesem oder jenem oder ihr selbst gegenüber albern und übertrieben fand. Andererseits nahm sie selbst sehr detailliert wahr und konnte Kleinigkeiten ungeheuere Beachtung schenken. Ich weiß bis heute nicht, all das, die ganze Art wie sie sich gab, nur Schüchternheit war.

Sie stellte sich als Sascha vor – vermutlich also Alexandra – und sagte, sie wolle nach Gorno Altaisk. Als ich das hörte, machte ich innerlich einen Luftsprung. Bis Gorno Altaisk, der Hauptstadt der Republik Altai, waren es 415 Kilometer. Wir würden also einen halben Tag zusammen fahren – länger, als ich zu wünschen gewagt hatte. Ich sagte, das sei ungefähr auch mein Ziel und ich könne sie die ganze Strecke mitnehmen. Wieder zeigte sie nur eine verhaltene Regung. Als wäre sie Buddhistin, die sich darin übte, alles zu nehmen, wie es kam. Bloß keine übermäßige Freude zeigen.
Nachdem diese ersten Informationen ausgetauscht waren, fuhren wir eine ganze Weile schweigend dahin. Die Sonne schien, es war noch nicht zu heiß, die Straße relativ leer. Perfekte Bedingungen. Obwohl ich andauernd hätte grinsen können über soviel Glück fragte ich mich, ob sie es bereits bereute, bei jemandem eingestiegen zu sein, mit dem sie sich nicht unterhalten konnte. Denn die obligatorische Frage, ob sie Englisch spräche, hatte sie verneint. Meine wenigen Worte Russisch genügten kaum zum Überleben, geschweige denn für eine Plauderei. An eine längere Unterhaltung war nicht einmal im Traum zu denken. Mehrere Stunden miteinander unterwegs und dabei zum Schweigen verdonnert zu sein konnten sehr unangenehm werden. Ich wollte unbedingt verhindern, dass diese Fahrt sie frustrierte und versuchte, ihr in hahnebüchenen russischen Sprach-Brüchstücken irgendetwas von mir zu erzählen. Erstaunlicherweise sprang sie mir nun mit ein paar ebenso unbeholfenen englischen Worten bei. Ich lachte: „Also kannst du doch Englisch?“ Nein, erwiderte sie, nur ganz, ganz wenig. Sie hätte alles längst vergessen. Da war es wieder, dieses Phänomen: die jungen Russen lernten in der Schule durchaus Englisch, schämten sich dann aber, es anzuwenden.
Sascha war nur etwas eingerostet. Besonders viel hatte sie zwar tatsächlich nicht parat. Aber was spielte das für eine Rolle? Es funkzanierte wunderbar. Von Minute zu Minute traute sie sich mehr, als sie merkte, dass ihr Englisch der Schlüssel zur Verständigung war. Ganz ähnlich wie Marija Garilowa von VW Nowosibirsk, nur schüchterner. Unser gesamter gemeinsamer Wortschatz bestand vielleicht aus einhundert Worten. Wovon mein Russisch weniger als ein Viertel ausmachte. Welch ausgiebige und sinnvolle Gespräche man mit so wenigen Worten führen kann, hätte ich nie für möglich gehalten. Alles, für das es keinen passenden Begriff gab, wurde umschrieben. So lange, bis der andere es verstanden hatte. Wieder und wieder. An Zeit mangelte es uns ja nicht. Jeder war des anderen Lehrer und gleichzeitig Schüler. Es gab eine Menge Aha-Momente auf dieser Fahrt.
Nach einer Weile erkundigte sie sich, wie ich überhaupt so lange ohne bisher klar gekommen sei – also ohne die russische Sprache zu beherrschen. Ich zeigte ihr meine Wörterbücher: ein kleines, grünes Reisewörterbuch, ein technisches Wörterbuch, ein politisches Wörterbuch, ein Schulwörterbuch und ein Zeigewörterbuch. Die lagen griffbereit in einer Kiste. Sascha lachte. Das Reisewörterbuch fand sie niedlich. „The little Translator“, wie sie es nannte, erhielt mit sofortiger Wirkung seinen festen Platz zwischen uns und wurde abwechselnd vom einen und dann wieder vom anderen in Anspruch genommen – unserer bester gemeinsamer Freund.
Das Radio war aus. Ich fragte Sascha, ob sie Musik hören wolle. Ja, warum nicht. Irgendetwas bestimmtes? Ach, das wäre ihr eigentlich egal. Ich fragte, welche Art von Musik sie möge – ich hätte verschiedenes dabei. Sie sagte, die Musik, die sie anhöre, würde ich bestimmt nicht kennen. Ja? Was denn? Ach, momentan gefiele ihr beispielsweise ein kaukasisches Pop-Liebeslied besonders gut, das auch arabische Elemente enthielte. Dazu mache sie immer das Licht in ihrem Zimmer aus. Sehr gut. Ich hatte mir schon gedacht, dass sie nicht dem Massengeschmack anhing. Außerdem, fuhr sie fort, möge Rammstein. Die Band würde ich vielleicht kennen. Natürlich. Auch das passte. Denn da war, wie erwähnt, dieses Düstere, Schwermütige an ihr. Ich stellte mir vor, wie sie nicht nur zum kaukasischen Liebeslied, sondern auch zu Rammstein ihr Zimmer verdunkelte, auf dem Bett lag und in irgendwelche Welten abdriftete.
Ihr großer Traum aber sei es, gestand sie, irgendwann einmal in Deutschland in einer Kirche ein Orgelkonzert zu hören. Sie sagte das so: „in einer Kirche.“ Nicht etwa in einem Konzertsaal.
Das kann nicht wahr sein, dachte ich, holte meine Best-of-Bach-CD aus dem Staufach, legte sie ein und zappte auf den fünften Titel: die Fuge aus Toccata & Fuge. „So etwas?“, fragte ich. Sie nickte. Danach kam ein Satz aus dem Brandenburgischen Konzert in G, danach die Suite Air. Sie legte ihren Kopf an die Seitenscheibe und starrte in die Ferne. Die CD lief durch. Sascha schwieg. Fünf Minuten, zehn Minuten . . . eine Viertel Stunde lang. Ich begann mich zu sorgen. Irgendwie sah sie traurig aus. Bei Titel Nummer 13, dem monumentalen „Kommt Ihr Töchter helft mir klagen“ aus der Matthäus-Passion, konnte ich nicht länger an mich halten und erkundigte mich, ob alles in Ordnung sei. Sie antwortete, das hätte etwas mit irgendetwas zu tun. Ich wusste aber nicht, was sie meinte. Sie nahm den little translator und schlug auf Deutsch das Wort „Stimmung“ nach. Ah, jetzt verstand ich. Dass sie schwieg, hatte etwas mit ihrer Stimmung zu tun! Ich wollte ihr zwar nicht zu nahe treten – vielleicht dachte sie an irgend ein schlimmes Ereignis aus der Vergangenheit – doch sie brauchte es ja nicht zu sagen, wenn sie nicht wollte. Also fragte ich: „Und wie ist deine Stimmung?“ Sie sagte: „Prekrasnyj“. Ich nahm den little translator und schlug, während ich fuhr, „prekrasnyj“ nach. Es bedeutete: wunderschön, wundervoll, herrlich …
II
Wir passierten Barnaul. Ich bot Sascha an, in die Stadt zu fahren, falls sie diese sehen wolle. Sie wollte nicht. Ich auch nicht. In Bijsk das Gleiche. Wir wollten beide endlich die Berge. Nichts anderes. Überland, weit außerhalb der Ortschaften, saßen Frauen und boten Pilze, Obst und Eingemachtes feil. Auf halber Strecke hielt ich und kaufte einem alten Mütterchen Heidelbeeren ab. Die Beeren mussten aus der offenen, transparenten Plastikschale in ein verschließbares Gefäß umgefüllt werden. Ich faltete ein Blatt Papier zu einer Rinne und bat Sascha, eine leere Flasche zu halten, während ich die Beeren durch die Öffnung kullern ließ. Das war das erste Mal, dass sie mir bei etwas half und nicht die Unbeteiligte blieb. Es fühlte sich gut an. Sascha meinte, die Beeren müsse man doch gleich essen; heute Abend würden sie nicht mehr schmecken, denn inzwischen war es heiß geworden. Ich erwiderte, ich würde sie mit Zucker und Milch zubereiten. Da schmeckten sie ganz sicher noch. Wenn sie wolle, könne sie auch etwas davon essen. Es wären ja genug Beeren für uns beide. Sie meinte oh nein, sie esse keinen Zucker. Und sie trinke auch keine Milch. Aha. Na gut. Ich nahm diese Aussage nicht besonders ernst. Wenn sie erst einmal von meinem Rezept versucht hätte, würde sie sich schon eines Besseren besinnen. Doch da kannte ich das Mädchen schlecht. Sascha befand sich nicht nur was Entfernungen anging, sondern auch ernährungsmäßig auf einer radikalen Selbsterprobung.
Ihre eigentliche Reise hatte in Orjol (Orel) begonnen, ihrer Heimatstadt, 400 Kilometer südlich von Moskau gelegen, wo sie „Ökonomie“ studierte – wie Alexanders Aussagen nach jeder zweite russische Student. Sie hatte Semesterferien und war bis hierher getrampt. 3600 Kilometer per Awtostop, wie man in Russland sagt. Die ganze Strecke mit LKW-Fahrern. Der letzte hatte sie eine halbe Stunde vor meinem Durchkommen dort ausgeladen, wo ich sie aufgelesen hatte. Irgendwie beeindruckte mich dieses Mädchen. Sie war Zwanzig – halb so alt wie ich – und wusste genau, was sie wollte. Mein erster Eindruck wurde, je länger wir fuhren, immer stärker: Es war seltsam und neuartig, mit „sich selbst“ zu reisen. Also mit einem ähnlichen Selbst, wie jenem, das man vor zwanzig Jahren gewesen war. Exakt in diesem Alter, mit Zwanzig, hatte auch ich mich ein Jahr lang auf Fleisch verzichtet. Mit Zwanzig hatte auch ich begonnen, abenteuerliche Touren ganz allein zu machen. Gut, Sascha war in der Hinsicht krasser. Doch sie hatte auch das entsprechend große Land dazu. Ich ahnte, dass ich sie verstand. Und da war noch eine Sache, die ich erahnte. Irgendetwas sagte mir, dass dieses Mädchen keinen Vater hatte. Entweder war er gestorben, oder er hatte die Familie verlassen. Sascha war zu hart zu sich, zu mutig, zu zielstrebig, zu nachdenklich, zu allein. Kein Vater der Welt (jedenfalls kein einigermaßen normaler) hätte sie in diesem Alter ohne Freund auf solch eine Tour gehen lassen. Volljährigkeit hin oder her.
Die Fahrt war lang. Nachdem wir beide festgestellt hatten, wie gut sich mit wenigen Worten ein Gespräch führen ließ, konnten wir gar nicht mehr damit aufhören. So verging die Zeit. Sie fragte mich, was ich so mache und weshalb ich hierher gekommen sei. Ich sagte, ich wäre Journalist und wolle eine Reportage über Russland schreiben. Das fand sie ungeheuer spannend. Gerade so, als wäre das eine wirklich fantastische Möglichkeit, um im Leben etwas Sinnvolles zu tun. Soviel positive Zustimmung war mir in Deutschland nie begegnet. Ich erwähnte auch, dass ich selbst Musik machen würde und ein bisschen was dabei hätte. Sascha reagierte nicht darauf. Ich fragte sie, welches Land sie gerne einmal bereisen würde und dachte an Italien, Frankreich oder die USA. Ihr jedoch fiel nur ein einziges ein: Deutschland. Deutschland und das Orgelkonzert. Nach einer halben Stunde – wir hatten uns inzwischen über alles Mögliche unterhalten – sagte sie plötzlich, sie wolle meine Musik hören. Also hatte sie es doch registriert. Ich legte diejenige der beiden CDs ein, von der ich annahm, sie würde ihr vielleicht eher zusagen. Sascha hörte die ganzen 49 Minuten aufmerksam zu, und kommentierte die eine oder andere Stelle. Bei einem der langsameren Stücke, das passenderweise The Pilgrim – Der Pilger – hieß, also von jemandem handelte, der unterwegs war, nahm sie the little translator und suchte nach einem passenden Begriff. „I like this song“, sagte sie, „it is… af-riksch-tisch.“ Ich begriff nicht und ließ mir das Wort zeigen. Aufrichtig, stand da. Ein schönes Kompliment. Das Mädchen verstand, was es hörte.
Endlich kamen die Berge. Sie waren einfach plötzlich da, wie aus dem Boden gestampft. Zwar noch kein Hochgebirge, dennoch Labsal für das Auge nach zweitausend Kilometern westsibirischer Ebene. Das Land war von einem ausgesprochen kräftigen Grün, beinahe Dunkelgrün, und erinnerte an Teile Thüringens, das Allgäu oder den Schwarzwald. Mit Beginn der Berge verließen wir die Region Altai und kamen in die Republik Altai – unser Ziel. Bis Gorno Altaisk waren es nur noch zwanzig Kilometer. Sascha würde dort aussteigen. Ein Gedanke, der mich plötzlich traurig machte, denn ihre Begleitung war sehr angenehm gewesen und ich wollte nicht allein weiter fahren. Ich fragte sie deshalb, ob sie tatsächlich nach Gorno Altaisk wolle. Nein, erwiderte sie, das hätte sie nur gesagt. Eigentlich wolle sie weiter, in die Berge, irgendwohin, wo genau wusste sie auch nicht. Irgendwo, wo es schön wäre und sie ein paar Tage ganz allein sein könne. Ohne Menschen. Später sagte sie das noch einmal genau so: „Ohne Menschen.„ Ich meinte: „Sascha, ich mache dir einen Vorschlag“ – das Wort wusste ich von Dima: Predloschenije –
„Ich will auch weiter. Und ich würde mich freuen, wenn du noch ein wenig mitfährst. Lass es uns so machen: wir schauen uns kurz in der Stadt um. Ich brauche dringend was zu essen. Und dann fahren wir weiter, irgendwohin, wo es schön ist. Wenn es dir dort gefällt, bleibst du da. Wenn nicht, kannst du so lange bei mir mitfahren, wie du willst. Was sagst Du?“
Diesmal lächelte sie wirklich, als sie einwilligte. Ich fühlte mich, als hätte ich einen Fünfer im Lotto gewonnen. Denn ich brauchte dieses Mädchen, allein schon der Sprache wegen. Und gegen die Einsamkeit. Auch für Sascha dürfte es ein Glücksfall gewesen sein, jemanden wie mich gefunden zu haben. Jemanden, der genau so unkonkret irgendwo hin wollte, „wo es schön ist“, der unabhängig war und über einen fahrbaren Untersatz verfügte. Zumindest bildete ich mir das ein. In sie hineinschauen konnte ich natürlich nicht.
In Gorno Altaisk fanden wir nach einiger Suche ein Asija Kafe. Sascha hatte offiziell keinen Hunger. Ich wollte herausfinden, ob ich ihr vertrauen konnte und ließ sie allein im Auto. Den Zündschlüssel nahm ich mit, nicht aber die Papiere und das Geld. Im Asija Kafe bestellte ich für 130 Rubel Suppe mit Fleischbällchen und setzte mich an ein Fenster. Von da aus konnte ich sie durch die Gardine beobachten, ohne dass sie mich sah. Sie blieb die ganze Zeit geduldig sitzen und bewegte sich nicht. Das war gut. Dann konnte ich einen Schritt weiter gehen. Denn am Abend wollte ich mit ihr anstoßen, musste also noch etwas Alkoholisches besorgen. Einfache Lebensmittelgeschäfte verkauften jedoch selten Alkohol, weil sie dafür eine extra Lizenz brauchten. Ich erkundigte mich nach Vino. Man beschrieb mir den Weg und ich bat Sascha, noch einmal kurz zu warten. Diesmal würde ich sie nicht im Auge behalten können. Was, wenn sie bei meiner Rückkehr mit meinem Geld verschwunden wäre? Das trieb mich zur Eile. Über einen Sandplatz, einen Parkplatz, einen Hinterhof, durch eine Eisentüre und dunkle Flure gelangte ich in das Innere eines Magasins. Die Decken waren niedrig. Das Ganze hatte eher den Anschein eines überdachten Vietnamesenmarktes. Es gab viel billigen Kram, Plastik-Schmuck, Zeug, das kein Mensch braucht. Und Alkohol. Ich kaufte eine Flasche Kadarka.
Um in Russland sicher zu gehen, dass billiger Wein auch genießbar (merke: nicht gut, nur genießbar!) ist, sollte er unbedingt süß sein. Billiger Trockener schmeckte – siehe Victors Cousin – wie bitteres Brechmittel. Die Flasche Kadarka kostete 267 Rubel. Das waren etwa 4,30 Euro. Günstiger ging es in Russland kaum. Wein ist also, auch wenn er billig ist, teuer – kein Vergleich mit hierzulande. Genießbaren trockenen bekommt man nicht unter 500 Rubel die Flasche. Sprich: mindestens 8 Euro nach dem damaligen Kurs. Zum Trinken nehme man daher lieber Schnaps. Soll es kein Wodka sein, eignet sich – siehe Victors Tankstellen-Mitarbeiter Dmitri – Cognac aus Armenien oder Dagestan. Der kostet in der Regel mehr, ist aber immerhin bezahl- und trinkbar. Richtig teurer Cognac aus den ehemaligen Sowjetrepubliken schmeckt absolut edel und kann es sicher auch mit sehr gutem französischen aufnehmen. Bei einer alten Dame in Kaliningrad hatte ich einmal dieses Vergnügen.
Sascha erwartete mich ohne Vorwurf, dass ich so lange weg geblieben war. Es konnte weiter gehen.
III
Nur war nicht genau klar, wohin. Da rückte sie mit der Information heraus, es gebe ein paar schöne Seen in den Bergen. Gar nicht so weit weg von Gorno Altaisk. Hundert Kilometer. Sie holte einen Hefter aus dem Rucksack und zeigte mir einen russischen Internet-Eintrag, den sie sich auf grauem DIN-A4-Papier ausgedruckt hatte. Sieh einer an, dachte ich. Da tut sie so, als ließe sie sich völlig treiben, und in Wirklichkeit weiß sie ganz genau, wohin sie will. Ich sah mir ihren Ausdruck an und suchte die Seen dann im Atlas Respublika Altai. Als ich sie auf der Karte gefunden hatte, war mir klar, dass ich das mit dem Bus nicht machen würde. Die Seen lagen auf 2000 Meter Höhe. Die letzten 30 Kilometer führten über eine unbefestigte Straße. Bis dahin wiederum waren es noch rund 80 Kilometer. Das würde alles in allem weitere drei Stunden Fahrt bedeuten. Es war bereits nach 16 Uhr und ich sah uns erst in der Dämmerung die Zelte aufbauen. Falls alles gut gehen würde – das heißt, falls die unbefestigte Straße ohne Allrad überhaupt zu bewältigen wäre. Würde dem Auto etwas zustoßen, würde ich dastehen. Mitten im Wald. Bei hereinbrechender Nacht… Gerne hätte ich ihr diesen Wunsch erfüllt. Doch die Wahrheit war: ich hatte heute keine Nerven mehr für einen Kampf Auto-gegen-Natur. Ich war schon sieben Stunden unterwegs und wollte endlich irgendwo ankommen. Da ich Sascha aber auch nicht verlieren wollte, sagte ich ihr, laut Karte sehe es so aus, als sei der letzte Abschnitt des Weges möglicherweise zu hart für den Bus. Dann müssten wir auf ein anderes schönes Plätzchen ausweichen. Das Finden schöner Plätzchen indes wäre meine Spezialität.
Es kam, wie ich befürchtet hatte: die Seen bedeuteten ihr viel mehr, als sie zugeben wollte. Seit Bijsk verlief die M52 am Katun, einem für seine Schön- und Wildheit gepriesenen Quellfluss des Ob. 65 Kilometer nach Gorno Altaisk überquerte ich den Katun auf einer neuen Hängebrücke und blieb auf der M52. Womit wir das Katun-Tal verließen und in ein Nachbartal fuhren. Unmittelbar nach der Brücke suchte ich eine Übernachtungsmöglichkeit. Doch am Fluss war es nicht schön – zugewuchert, absolut unzivilisiert. Der Wald schien wieder so gefährlich wie damals im Ural. Es roch förmlich nach Bären. Außerdem konnte man nicht hinunter zum Ufer; die Böschung war einfach zu steil. Waschen wäre unmöglich. Nicht der Platz für diese Nacht. Sascha wies mich darauf hin, dass wir zu den Seen nicht über die Brücke hätten fahren dürfen und fragte, weshalb ich nicht auf der anderen Straße geblieben wäre. Sie meinte, man könne es doch wenigstens versuchen.
Um sie nicht zu enttäuschen, aber auch, weil es mir hier selbst nicht gefiel, kehrte ich um, überquerte noch einmal den Katun und fuhr zurück in das andere Tal. Tatsächlich war es da viel schöner. Neben dem Asphalt trotteten gemächlich Kühe und Pferde. Sie bewegten sich völlig frei, ohne Zaun. Man sah wieder Menschen und kleine Siedlungen. Der Fluss rechts der Straße war hier besonders gut zugänglich, ziemlich breit, mit gelegentlichen Stromschnellen und wilden Felsen. In vollbesetzten Schlauchbooten hatte Urlauber oder Abenteuerer ihren Spaß. Alles sah deutlich touristischer aus und lud geradezu zum Verweilen ein. Am Ufer, im lichten Wald, reihte sich bald Feriendorf an Feriendorf. Überall warb man mit Banja, Restoran und diversen Freizeit-Möglichkeiten. Doch das war noch nicht das, was ich suchte. Ich wollte etwas anderes. So etwas: nach einer Kurve öffnete sich auf der linken Seite eine langgezogene, tief ins Land hineinreichende Wiesenebene. Ein paar Pferde grasten unter einer Baumgruppe. Am Ende der Ebene fuhren die Berghänge steil in die Höhe. Rechts der Straße, am Fluss, war ein kleiner, sehr einfacher Campingplatz. Hier gefiel es mir! Ich sagte zu Sascha, wenn wir es nicht zu den Seen schaffen, dann wird das unser Platz. Wir fuhren weiter. Es wurde nicht mehr schöner. In Elekmonar waren erstmalig die Seen ausgeschildert. Wir fuhren bis Tschemal. Auch dort wieder der Hinweis: Karakololskije Ozera – Karakol Seen. Doch auch Sascha wurde es nun lang. Als wir endlich die Abbiegung sahen, die schlechte Straße, die zu den Seen führen würde – und das im besten Falle noch mindestens eine Stunde lang – beschlossen wir, zurückzufahren. Immerhin gab sie mir recht: nichts für den Bus.

Der Campingplatz war perfekt. Unser gemeinsames Werk. Denn ohne ihr Beharren auf die Seen hätte ich ihn nicht gefunden. Wir bekamen gleich einen guten Platz mit zwei überdachten Bänken und einem Tisch. Nichts stand einem gemütlichen Abend im Wege. Zuerst wuschen wir uns im Fluss. Natürlich getrennt. Eiskaltes Gebirgswasser aus Gletschern. Aber ich schaffte es immerhin, unter Saschas heimlicher Beobachtung ganz unter zu tauchen. Womit ich ihren Respekt gewann, denn ich fürchte, sie hielt mich für ein wenig verweichlicht, weil ich angenehme Dinge nicht wie sie strikt anlehnte. Erneut wunderte sie sich, dass ich von Deutschland aus hierher gefunden hatte. So weit. Ganz allein. Sie nannte mich molodjez. Ich schlug das Wort nach. The little translator übersetzte es mit Prachtkerl.
Ich hatte Jewgeni in Tomsk beim Austauschen des Dieselfilters eine Frage gestellt, die er kurz und knapp mit „jehst“ (ja, gibt es) beantwortet hatte. Das war für mich wie eine Erleuchtung gewesen. Seitdem setzte ich „jehst“ („sein“ in der 3. Person Singular Präsens) völlig ungezwungen als mein Universal-Hilfsverb ein und stellte es allen möglichen Worten voran: Hier jehst dies, dort jehst das . . . tyj jehst krassiwuyj... Ich wusste, dass es grammatikalisch falsch war, denn niemand sprach so. Doch nur so verstand ich selbst, was ich sagte – und vermutlich deshalb verstand man mich auch immer.
Das Kompliment ging postwendend an Sascha zurück: tyj jehst molodjez.
Ich baute mein Zelt auf. Sascha hatte keines, sondern wollte in einem Biwak-Sack auf einer dünnen Schaumstoffmatte auf dem nackten Boden schlafen. Mir grauste es bei dem Gedanken, ich müsste ohne jeglichen Komfort auf der kalten, festgetretenen Sanderde nächtigen. Ich sagte, es würde sicher ziemlich kühl – zumal am Fluss – und bot ihr mein Zelt und meine Luftmatratze an. Selbst hätte ich dann im Auto geschlafen. Wie konnte ich nur! Wie konnte ich nur annehmen, sie würde sich das großartige Erlebnis, unter dem offenen Sternenhimmel zu schlafen, entgehen lassen. Darum ging es doch schließlich, wenn man hier her kam! Ich sagte, dann nimm wenigstens noch eine von meinen Decken oder eines der Schaffelle. Keine Chance, das Mädchen blieb so hart wie der Boden, auf dem sie schlafen wollte.
Die Chefin des Campingplatzes kam vorbei und kassierte 300 Rubel – nicht mal 5 Euro. Ich bezahlte für uns beide und sagte Sascha nichts davon. Dann aßen wir zu Abend. Für mich gab es Brot, Wurst und Heidelbeeren mit Zucker und Milch; für Sascha Körner aus der Tüte. Ich wollte es nicht glauben: sie verschmähte einfach meine Heidelbeeren! Nicht eine einzige Beere nahm sie in den Mund. Ich öffnete den Wein und wollte ihr eine Tasse einschenken. Natürlich trank sie auch keinen Wein. Wieder konnte – musste – ich sie verstehen: auch ich hatte mit Zwanzig keinen Alkohol getrunken. Ich war damals Sportler gewesen und kaum etwas erschien mir so wichtig, wie körperliche Vervollkommnung. Allerdings hatte ich wenigstens Milch und Saft getrunken. Sascha hingegen trank ausschließlich Wasser und zur Krönung des Tages ein Tässchen ungesüßten Tee. Sie aß Samen, Nüsse und getrocknete Früchte; später auch irgendetwas aus Dosen, das aussah wie Seegras. Obwohl ich es immer wieder versuchte – zuletzt nur noch, um sie zu necken – stieß ich regelmäßig auf Granit mit all meinen Versuchen, ihr „etwas Richtiges“ anzubieten. Ich wunderte mich oft, woher sie die Energie für unsere Tagesetappen nahm. Aus den paar Körnern konnte sie nicht kommen. Ich verstand auch nicht, wie man Freude empfinden konnte, wenn man sich jeden Genuss versagte. Du bist eben älter geworden, dachte ich.
Meine Flasche Kadarka musste ich also allein trinken. Ich befürchtete schon, es gäbe nichts, was wir gemeinsam tun könnten und schaute etwas wehmütig zu unseren Nachbarn, die ein Feuer gemacht hatten, Karten spielten und lustig waren. Ich machte eine Bemerkung, wie schön es doch wäre, jetzt auch Karten spielen zu können. Sascha fragte, ob sie für uns die Karten borgen solle, ging aber, ohne meine Antwort abzuwarten, sogleich los und kam kurz darauf mit ihrer Errungenschaft zurück. Sie schwärmte von einem russischen Spiel und versuchte, es mir unbedingt beizubringen. Das Blatt bestand aus 36 Karten. Wie unser Skatblatt, plus der 6. Ich gab mir leidlich Mühe, kapierte aber bis zum Ende nicht, was ich tun musste und wie das Spiel funkzanierte. Hier kam unsere eingeschränkte Möglichkeit, sich zu verständigen, dann doch an ihre Grenzen. Nach dem ersten Spiel, das Sascha letztendlich für uns beide spielte, hatte ich keine Lust mehr und es war auch schon dunkel geworden. Bei mir wirkte der Wein, bei ihr der Sternenhimmel. Wir wünschten uns Gute Nacht und gingen schlafen.
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.





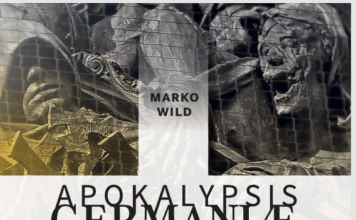

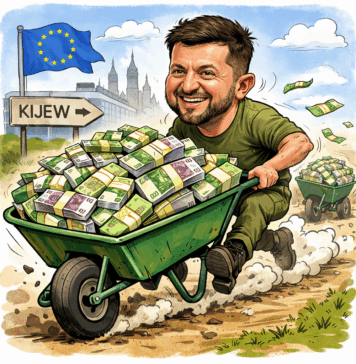

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.