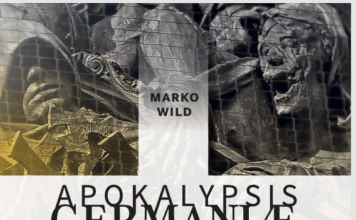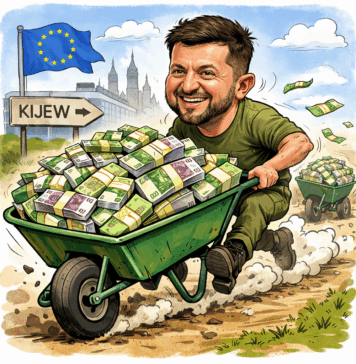Ein Roadmovie von Marko Wild (Teil 1)
„Der Mensch bereist die Welt auf der Suche nach dem, was ihm fehlt. Und er kehrt nach Hause zurück, um es zu finden.“
– George Moore –
1. Kapitel – Der Nagel
Alles begann mit einem Nagel. Und alles trug sich genau so zu. Nun ja, im Großen und Ganzen. Doch wie erzählt man 15.000 Kilometer quer durch Russland bis in die Mongolei und zurück? Ich könnte eine einfache Nummernrevue abspulen: Erst waren wir hier, anschließend dort. Hier haben wir dieses, dort jenes gesehen und gegessen. Alles war ganz toll. Naja, auch ein bisschen stressig. Aber auch sehr aufregend… Ich könnte im Stil feuilletonistischer Reiseautoren schreiben: verwende eine flüssige Sprache, langweile Deine Leser nicht, bilde kurze Sätze und kreiere unverbrauchte Bilder. Versuche stets die Stimmung einzufangen. Halte Dich nicht mit Unwesentlichem auf, flechte aber immer wieder Details ein – das wirkt authentischer. Zeitgemäßer Informationsgenuss, mundgerecht zum Verzehr bereitet, um den Weltgewandten ein zufriedenes „delikat“ zu entlocken.
Doch damit würde ich Russland nicht gerecht.
Ich könnte mich auch ganz kurz fassen. Die wesentlichen Erkenntnisse komprimiert wieder geben. Doch dann würden Sie, lieber Leser, zu vieles nicht verstehen. Denn das Leben ist mehr als eine Erkenntnisformel. Um uns kurz zu fassen sind wir überhaupt nicht hier, habe ich Recht? Wir Menschen, meine ich. Es gibt etwas zu tun – und dann gibt es etwas zu erzählen. Und das braucht Zeit. Weil Herz und Verstand selten die gleiche Geschwindigkeit haben.
Nein, ich wollte von Anfang an etwas anderes. Ich will, dass Sie es mit dem Herzen begreifen, nicht nur mit dem Verstand. Deshalb muss ich es anders erzählen… Russland ist groß. Es kann sich gar nicht schnell enthüllen. Also lassen Sie sie mich auch so erzählen, die ganze Geschichte jener wundersamen, abenteuerlichen Fahrt, die mich weit weg und wieder zurück nach Deutschland brachte. Nach Hause. Doch das sollte ich erst spät begreifen.
Es ist eine Geschichte von Neugier, von Sehn- und Fernsucht. Eine Geschichte über Tapetenwechsel – wie Victor sagen würde, den Sie noch kennen lernen werden. Eine Geschichte von jemandem, der, obwohl er fuhr, so weit gehen wollte, wie niemals zuvor. Von einem, der auszog, nicht um das Fürchten zu lernen (obwohl er es lernte), sondern, um zu erfahren, dass es Orte gibt, die sich nicht neu erfinden, austauschen oder willkürlich festlegen lassen, indem man einfach den Finger auf der Landkarte verschiebt. Orte, an denen, wie mit einem unsichtbaren Gummiband fest gebunden, das eigene Herz hängt – ob man diese Orte nun mag oder nicht. Und je weiter das Herz dieses Gummiband dehnt, eine desto stärkere Wirkung beginnen diese Orte zu entfalten. Dann ziehen sie dich, ziehen dich mit unnachgiebiger Kraft dorthin zurück, wo du hergekommen bist. Wo irgendwann einmal jemand, als du geboren wurdest, mit einem unsichtbaren Hammer einen unsichtbaren Nagel in den unsichtbaren Boden der Welt schlug, dich daran festband und damit auf alle Zeiten bestimmte (entschied?), wo du hingehörst. Auch, als du nach und nach deine Streifzüge ausweitetest und dein Revier vergrößertest und dieser Jemand, der einst den Nagel eingeschlagen hatte, im Laufe der Jahre bereitwillig dem unsichtbaren Gummiband zugab und zugab – hunderte Kilometer, tausende… Soviel du auch verlangtest. Nur eines tat er nie, weil er es nicht tun konnte, nicht tun durfte, weil nichts einfach ungeschehen gemacht werden kann, weil alles eine Geschichte mit einem Anfang ist und dieses Alles zerfällt, sinnlos wird, wenn man den Anfang auslöscht: Was der Nageleinschlager nie tat, war, den Nagel wieder herauszuziehen und das Gummiband zu durchtrennen. Denn das hätte bedeutet, dass du fortan ohne Halt durch Raum und Zeit taumelst. Zuerst würdest du dich vielleicht für „frei“ halten; in Wahrheit jedoch wärst du dann vogelfrei. Und verloren, wenn es dir nicht gelänge, selbst irgendwann irgendwo einen Nagel in den Boden der Welt zu rammen, zu kratzen, und dich daran zu festklammern wie am letzten Fitzelchen Haken in der Felswand, damit du nicht hinausdriftest in dieses schaurig-tiefe, unendlich einsame Weltall und in der schwarzen Leere nie mehr gefunden wirst. Doch wer sagt dir – wer gibt dir Gewissheit – dass du selbst den richtigen, den besten Ort für deinen Nagel finden und auswählen wirst, wenn du allein es bist, der ihn suchen muss? Die Unmöglichkeit dieser Gewissheit erkennt man auf einer langen Reise, auf der man viele, viele Orte unter der Prüftinktur namens „Suche-nach-einem-Plätzchen-für-einen-Nagel“ inspiziert. Und sei es nur beiläufig, unbewusst. Einer Reise, die nach vier Fünfteln des Weges den, der ausgezogen war, um soweit als möglich fort zu gehen, niederstreckte und ihn be- (und er-)kennen ließ:
Lass mich nach Hause! Lass mich bitte, bitte nach Hause! (Also habe ich ein Zuhause…)
Die Geschichte, die ich erzählen will, ist eine Geschichte über vieles, das größer ist, als man selbst. Also auch eine Geschichte über die Liebe. Über Liebe und ruhelose Herzen, über Geld und Autos, über Segelboote und Frauen, über gute und schlechte Menschen, über das Gefängnis, über Wunder, über Gott, den Anfang und das Ende der Welt – und über Diesel.
Vor allem aber ist es eine Geschichte über Russland. Im Jahre des Herrn 2015, dem Jahr, in dem der europäische Wahnsinn allmählich ohrenbetäubend wurde und mich forttrieb, lag die kaum besiedelte Weite Sibiriens da und wartete. Still und genügsam, das Verrinnen der Zeit ausseufzend, schenkte sie den fernen Turbulenzen kaum Beachtung. Zu groß das Land, zu weitab seine Städte. Russland, Sibirien besonders, hatte sein eigenes Tempo, seine eigene Arbeit, seine eigenen Kümmernisse, seine eigenen Antworten. Es wusste, was es kann und es fürchtete sich nicht. Da hinein begab ich mich und überließ mich seiner nach menschlichem Ermessen ungeheueren Grenzenlosigkeit, die mich am Anfang erstaunte, später ängstigte und mir zuletzt Frieden brachte vom europäischen Dauerstress.
Zu guter Letzt ist dies eine Geschichte darüber, dass man zwar vieles versuchen, aber nicht alles erzwingen kann. Dass es trotz grenzenloser Möglichkeiten immer noch Grenzen des Möglichen gibt. Des Nagels wegen. Es ist nicht das Schlechteste, mit Hilfe Russlands etwas zu begreifen, das man zurückgelassen hat – jenen Ort, an den man hingehört. Und dass dieser Ort irgendwie wundervoll sein muss. Auch wenn man bis dahin gar nicht wusste, dass er es war, den man eigentlich suchte, als man aufbrach.
II
Zunächst aber wollte ich weg. Weg von diesen – wie ich dachte – vorgärtengießenden, laubzusammenharkenden, kreditabzahlenden, dienstbeflissenen, pflichtbewussten deutschen Wohlstandsakkumulierern. Ich wollte einmal etwas anderes sehen. Wollte wieder staunen, mich wieder überraschen lassen.
Mein Leben in Deutschland war vorhersehbar wie der 20-Uhr-Gong der Tagesschau. Alles in mir strebte hinaus in die Weite. Tausende Kilometer fahren. Fahren, fahren, fahren! Ohne detaillierte Planung. Die Straßen unter meinen Reifen durchschiebend wollte ich immer weiter, eine halbe Erdumdrehung weit. Richtung Osten. Richtung Geheimnis. Denn der Westen hatte sich entzaubert, bot keine Geheimnisse mehr. Nur noch böse Überraschungen.
Ich wollte wieder entdecken. Ich wollte fallen. Ohne Sicherheitsnetz. In die Daunen eines sehnsüchtig imaginierten, fremden Glücks, der sprudelnden Abenteuer-Endorphine, des Rausches von neuen, ungesehenen Gegenden und Landen, des Duftes ferner Bäume und Wiesen, des majestätischen Dahinströmens riesiger Flüsse, der Begegnung mit anderen Menschen, anderen Bräuchen, anderen Worten, anderen Namen und anderen Geschichten. Ich hoffte, zu fallen und nicht allzu unsanft aufzuschlagen. Wie ich bislang eigentlich immer recht gut gelandet war.
Russland. Seit meiner Kindheit lockte mich dieser Klang. Wie das kurze, harte Raspeln von trockenem Holz. Es liegt etwas in diesem Klang, das mit Händen getan werden muss, das anstrengend, aber ehrlich ist. Das Mut erfordert und in dem nur der besteht, der bereit ist, die Bequemlichkeit hinter sich zu lassen um der Belohnung willen, die ihn jenseits der Strapazen erwartet. Russland – dazu brauchte man Glauben. Glauben, sein Los in die Hände von etwas Gewaltigem zu legen und darauf zu vertrauen, dass dieses Gewaltige auch zärtlich sein kann und sich um einen kümmert – trotz aller Schläge. Und in der Tat kam mir später, als ich durch die Weite fuhr, immer wieder der Gedanke, was Gott sich wohl gedacht haben mochte, als er Russland erschuf.
Mit sechs Jahren hatte ich einen großen Weltatlas bekommen. Zum Schulanfang. Seitdem fasziniert mich die Darstellung der Erde. Bald ahmte ich die Kartographie nach, zeichnete wie hypnotisiert von der Schönheit der Linien Küstenverläufe und Flüsse, sammelte allerlei Landkarten, Tabellen und Statistiken und wusste irgendwann geografische Daten so umfassend auswendig, dass es meiner Erdkundelehrerin zum Sport wurde, eine Frage zu finden, die ich nicht beantworten konnte. Ein einziges Mal nur in meiner gesamten Schulzeit erwischte sie mich auf dem falschen Fuß: Ich konnte den Hudson River nicht zeigen. Ein totaler Blackout, denn ich wusste ja, dass New York am Hudson liegt. Diese „Niederlage“ bleibt unvergesslich. Man hätte mich noch im Halbschlaf fragen können, wie hoch die Bevölkerungsdichte von Indien 1978 und 1986 gewesen sei, wie viele Quadratkilometer der Tschadsee habe, wie die Reihenfolge der größten Millionenstädte nach den jüngsten Zählungen mit Angabe der Einwohnerzahlen wäre oder wie die Nebenflüsse des Mississippi der Länge nach geordnet heißen. Ich kannte nicht nur die geografischen Superlative jedes Kontinents, sondern auch wie es danach weiter ging: Zentralmassiv, Rila-Gebirge, der Fluss Oranje in Südafrika, Guadalajara, Ebro und Tajo (übrigens Tajo auf Spanisch – Tejo auf Portugiesisch). Ich betete die bekanntesten Inseln und die Quadratkilometer ihrer Fläche herunter, hätte ihre Gestalt zeichnen können, die Buchten, die vorgelagerten Halbinseln; ich kannte Senken, heißeste und kälteste, niederschlagsreichste und -ärmste Orte, Vegetationszonen, die Fauna des gesamten Erdballs, Erzvorkommen, Kali, Bauxit, Agrargebiete. Kurz: Mein Wissen war beinahe enzyklopädisch. Erdkunde wurde von mir im Vorübergehen erledigt. Die Schule war mir stets zu wenig. Das Lichtbild einer sonnigen neapolitanischen Gasse, über die hoch oben italienische Frauen Wäscheleinen gespannt hatten, zog mich bereits in der 6. Klasse zum ersten Mal in die Welt. Ich büxte zum Leidwesen meiner Eltern von zu Hause aus, um diesen Ort zu finden. Zwar kam ich keine 30 Kilometer weit. Doch eine Grenze hatte ich schon damals überschritten. Mit 14 wollte ich Kartographie studieren. Und irgendwann alles mit eigenen Augen sehen, wohin ich bis dahin nur auf dem Atlas reisen konnte. Das würde schwer, wenn nicht unmöglich werden, denn mein Land war die DDR.
Eine faszinierende Option jedoch hielt selbst die DDR für mich bereit: Den großen Bruderstaat. Es beeindruckte mich, dass die Sowjetunion nicht einfach irgendein Land war, sondern das flächengrößte und mit einer Reihe geografischer Extreme aufwartete, wie man sie sonst in ganzen Kontinenten nicht findet. Neben dem größten zusammenhängenden Waldgebiet der Erde (größer als der Amazonas-Regenwald) – dem Nadelwaldgürtel der Taiga – und dem 7495 Meter hohen Pamir-Gebirge, waren hier vor allem die russischen Gewässer beeindruckend: der Baikalsee und die Flüsse. Ich möchte die Relationen einmal verdeutlichen und hoffe, nicht zu langweilen. Russland, das „nur“ ein Land ist, hat zwei Flusssysteme von über 5000 Kilometer Länge (Ob-Irtysch, Jenissej-Angara) und zwei Ströme von über 4000 Kilometer Länge (Lena, Amur). Sie können mir glauben, dass allein diese Zahlen genügten, um mich für Russland zu begeistern. Denn was hatten wir in Deutschland schon? „Vater Rhein“, eine der verkehrsreichtsen Wasseradern der Welt, der nach letzter Vermessung nicht 1320, sondern nurmehr 1232 Kilometer lang ist? Von denen er ganze 715 Kilometer durch andere Länder fließt oder deutscher Grenzfluss ist? Die Elbe? Ein Fünftel der Donau? Das waren nicht wirklich große Flüsse. Angesichts des Rheins am deutschen Eck eine faszinierende Vorstellung. Wieso sollte ich das alles nur aus dem Atlas oder dem Fernsehen kennen? Wieso diese Dimensionen nicht einmal mit eigenen Augen sehen, sie durch mich hindurch gehen lassen, wie eine Brise durch ein Windspiel und schauen, was sie meiner Seele entlocken würden? Seit ich Kind war, wollte ich diese Welt. Mit all ihren herrlichen Formen, Umrissen und Linien wollte ich sie. Ich wollte am Ufer stehen, hinunter blicken und sagen können: Das, dieses Gewaltige hier, was sich vom linken bis zum rechten Horizont erstreckt, ist nur ein kleiner Teil der Flussbiegung aus dem Atlas, auf jener Karte mit dem Maßstab 1:12 Millionen…
III
Jede große Reise braucht einen Zweck. Ohne einen solchen wollte und konnte ich nicht aufbrechen. Auch mental würde die Reise sonst nur schwer durchzustehen sein. Sechs Wochen ziellos herumfahren wäre nichts für mich. Glücklicherweise boten sich gleich mehrere Themen an, dem Vorhaben ein Sinngerüst zu verleihen. Meine Planung konzentrierte sich zunächst auf zwei: Russlanddeutsche und Nowosibirsk.
Vor Jahren hatte ich über einen befreundeten Theologen eine kleine Gemeinde russlanddeutscher Aussiedler kennen gelernt. Alte Leute, kaum jemand war jünger als 60. Ich besuchte sie ein paar Mal und es schien mir, als wollten sie mich auffressen vor Dankbarkeit darüber, einen jüngeren Menschen in ihrer Mitte begrüßen zu dürfen. Mit ihrer einfachen Art, der schlichten baptistischen Frömmigkeit, dem altdeutschen Dialekt und ihrer überwältigenden Herzlichkeit hatten sie mich im Sturm erobert. Solche Menschen wirken heute beinahe wie Außerirdische. Zumindest war ich ähnlichen Leuten in Deutschland noch nie begegnet. Sie glichen einer schon ausgestorben geglaubten Schmetterlingsart, deren Raupen man beim Entrümpeln ganz hinten unterm Dachstuhl entdeckt. Ich wollte wissen, wo diese Menschen herkamen, wollte ihren Ursprüngen nachforschen und herausfinden, ob irgendwo in Sibirien heute noch dieses Oberschwäbisch gesprochen würde, wollte sie fragen, ob sie zu bleiben gedächten oder ebenfalls zu gehen beabsichtigten. Und weshalb. Ich wollte sehen – falls etwas davon in Sibirien überlebt hätte – welche Kultur einmal von Deutschland in die Welt ausgegangen und zu welcher Form sie dort konserviert worden war. Wollte also, ohne mir dessen bewusst zu sein, möglicherweise auch nach den eigenen Ursprüngen suchen.
Denn jene oben erwähnten Russlanddeutschen hatten ein mir seltsam vertrautes Schicksal durchgemacht: Sie waren gen Westen gezogen in der Erwartung, ins gelobte Land zu kommen. Doch jener Westen war eisig, kurz und heftig über sie hinweggefegt. Anstatt sie herzlich aufzunehmen, hatte er ihnen, wie sie sagten, die Kinder genommen, die sich, kaum angekommen, in Windeseile vom Weltbild und Lebensmodell der Eltern lossagten. Zurück blieben alte Leutchen, die auf Erden so heimatlos geworden waren, wie man es nur werden konnte: In Russland waren sie die Deutschen gewesen, in Deutschland die Russen. Dort die alte Heimat der Vorfahren zweihundert Jahre lang in der Erinnerung mit sich herum getragen, nur um mit der Rückkehr in die vermeintliche Heimat festzustellen, dass diese sie weder wollte noch brauchte. Dass das alte, früher oft verschmähte Russland ihnen heute, in der neuen Fremde, mehr Heimat war, als sie es dort je empfunden hatten. So war ihnen jegliche Heimat immer nur Erinnerung – als sei dies ein ganz spezieller Fluch, den sie zu tragen hatten.
Vielleicht konnte ich ansatzweise nachempfinden, wie es ihnen ergangen sein musste, denn auch ich hatte meine ehemalige Heimat, die DDR, in kürzester Zeit auf Nimmerwiedersehen verloren, allerdings ohne dass mich je einer gefragt hätte, ob ich dies alles so haben wollte oder nicht. Der Westen war so anders. Vielleicht hatte meine Reise weit nach Osten auch eine symbolische Komponente. Der Osten hat mit Vergangenheit zu tun, weil die Sonne den Osten zurücklässt, weil die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat eine Wunde ist, die einem von der Geschichte zu einem Zeitpunkt geschlagen wurde, an dem man noch viel zu klein war, um zu begreifen, wie schlimm und wie tief diese Wunde in Wahrheit ist. Später versucht man, diese Wunde zu schließen. Die russlanddeutschen Baptisten hatten ihre Methode gefunden: Sie lebten nur noch aus der Hoffnung auf das Jenseits. Der Vereinigung mit Gott, dem Einzug in ihre ewige himmlische Heimat. Ich war noch nicht so weit. Ich musste nach Sibirien. Dorthin, wo sie herkamen: Zurück.
Auf Nowosibirsk war ich durch eine Meldung aus dem Jahre 2013 aufmerksam geworden. Nowosibirsker Wissenschaftler hatten aus Meteoritengestein Bohrspitzen hergestellt, die die x-fache Härte des härtesten bekannten Werkstoffes, Diamant, erreichten. Das lenkte mein Interesse auf Akadem Gorodok, das „akademische Städtchen“, am südlichen Nowosibirsker Stadtrand gelegen und einst auf Befehl der Sowjetführung aus dem Boden gestampft, um die sowjetische Naturwissenschaft und Forschung vor dem Krieg und den Deutschen in Sicherheit zu bringen. Doch das war lange her. Was würde heute davon noch übrig sein? Auch das wollte ich herausfinden.
Die Bedeutung Nowosibirsks, so meine Hypothese, wird aufgrund seiner günstigen Lage in dem Maße steigen, in dem sich der Westen mit Russland überwirft und Russland sich deshalb China zuwendet. Ich wollte dahin fahren und sehen, ob dem tatsächlich so war, wollte verstehen, wie die Hauptstadt, die Boom-Town Sibiriens funktioniert, mit welcher Frequenz und Dynamik sie pulsiert – kurz: Was dort geht, wie man neudeutsch sagen würde. Das Potential Sibriens erschien mir jedenfalls gewaltig. Sollten Russland und China ihre gemeinsamen Projekte unbehelligt verfolgen können, müsste der Nowosibirsker Raum in den kommenden Jahrzehnten geradezu üppig gedeihen und zu einem Motor nicht nur der russischen Wirtschaft werden. An der geplanten Hochgeschwindigkeitsbahn von China über Kasachstan bis Budapest zeigt, wurde mir deutlich: Die Zukunft gehört Sibirien. Wie sollte es anders sein?
Russland und China – dem begegnete ich auch im Kleinen. Auf YouTube fand ich das Video einer chinesischen Austauschstudentin. Ein nettes, kleines Dokument ihrer Zeit in Nowosibirsk. Lachende Freundinnen in einem Café, Impressionen vom Shoppen. Das Video an sich war unspektakulär. Aber es begann mit einem wunderbaren, von einer Frau gesungenen Lied. Dieses Lied verband ich forthin mit Nowosibirsk. Ich brachte es mir auf der Gitarre bei und lernte auch den russischen Text zu singen. Ein einziges russisches Lied… Und doch sollte mir genau dieses Lied noch glückliche Dienste erweisen.
Und dann war da noch ein drittes Interesse. Allerdings weniger von journalistischer Natur. Ich wollte die Gelegenheit – wo ich sozusagen schon mal da war – nutzen und in den geheimnisvollen Altai fahren. Dieses kleine, zentralasiatische Hochgebirge fesselte meine Aufmerksamkeit schon länger. Wegen seiner gepriesenen Naturschönheiten und einiger seltener Tierarten, wie dem Riesenwildschaf (Argali) oder dem Schneeleoparden und seiner überreichen alpinen Flora. Die einen verglichen die Reize des Altai mit den schönsten Gebirgen Europas. Andere hoben seine anthropologische Bedeutung hervor: Höhlenmalereien, Hügelgräber und andere Zeugnisse einer uralten, frühgeschichtlichen Zivilisation. Dritte wiederum erwähnten raunend seine Bodenschätze. Vor allem das Gold. „Altai“ ist mongolisch und bedeutet „(Berge) mit Gold“. Auf meinem Desktop gab es seit Jahren den Ordner „Altai“. Auch besaß ich Kopien dreier sowjetischer Altai-Generalstabskarten. Die hütete ich wie einen Schatz.
Von all diesen Gründen abgesehen, wollte ich, was immer in meiner Macht stand, tun, um dem arg geschundenen Verhältnis zwischen Russland und Deutschland Linderung zu verschaffen. Und sei es auch nur das kleinste Tröpfchen auf dem heißen Stein – es sollte mein Beitrag sein. Ich nahm mir vor, als „Gesandter“ auch all jener aufzutreten, die in Russland keineswegs das Böse sahen, die die russische Politik nicht dämonisierten oder fürchteten, die jedoch keine Möglichkeit hatten, dies zu vermitteln. Ich wollte zeigen, dass unter vielen Deutschen immer noch Zuneigung zum russischen Wesen und einem Land vorhanden ist, mit dem Deutschland so viel mehr verbindet als jener elende Krieg vor 70 Jahren. Auch diesbezüglich sollte ich erstaunliche, rührende Erfahrungen machen.
Mich trieb also ein ganzes Potpourri an Interessen und Motiven. Mehrmals wurde ich gefragt, weshalb ich gefahren sei – so weit, so ganz allein. In diesen Momenten war ich jedesmal froh, mir vorher Gründe zurechtgelegt zu haben. Diese rezitierte ich dann, wie ein auswendig gelerntes Verslein. Weil mir der eigentliche Grund – die Suche nach dem unsichtbaren Nagel – damals selbst noch unbekannt war. Und dennoch überschattete er alles.
Schlussendlich wollte ich meine Eindrücke zu mehreren Reportagen verarbeiten. An einen Reiseroman hatte ich nie gedacht.
Doch es wurde alles so viel mehr…
***
Fortsetzung folgt
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.