Gastbeitrag von Edgar L. Gärtner
Das Armutsgelübde ihres römisch-katholischen Bettelordens hat berühmte Dominikaner wie den Italiener Thomas von Aquin sowie später die Spanier Domingo de Soto und Juan de Mariana nicht davon abgehalten, die geistigen Grundlagen des Kapitalismus in Form des zivilen Naturrechts und zu erarbeiten. Der wenigstens partielle Übergang zur kapitalistischen Form des Wirtschaftens hat es seit dem Ende des 20. Jahrhunderts Milliarden von Erdenbürgern ermöglicht, der Armut zu entkommen.
Die meisten der heute lebenden Menschen verdanken ihr Überleben buchstäblich dem Kapitalismus, denn die vorkapitalistische Subsistenzwirtschaft ermöglicht nicht die Ernährung von über 8 Milliarden Menschen. Da der Kapitalismus eine Wirtschaftsweise, aber kein geschlossenes System darstellt, ist er auch ohne Weiteres mit religiös begründeter freiwilliger Armut vereinbar.
Das Lehrschreiben „Dilexi te“
Doch unser neuer Papst Leo XIV., dem ich als einfacher Gläubiger eine Gnadenfrist eingeräumt habe, schloss sich kürzlich in seinem ersten Lehrschreiben (Apostolische Exhortation) mit dem Titel „Dilexi te“ (deutsche Kurzfassung hier) ausdrücklich dem Verdikt seines Vorgängers an: „Diese Wirtschaft tötet.“ Er umschreibt das lediglich mit etwas anderen Worten, indem er die nationale Abschottung und Ausgrenzung der Armen beziehungsweise Zurückweisung von Migranten anprangert und die unter US-Präsident Donald Trump verfügte Kürzung von Sozial- und Entwicklungshilfe-Programmen als unchristlich verdammt. Stattdessen fordert er weltweite solidarische Zusammenarbeit ausgehend von den Bedürfnissen der Armen. Mit jedem zurückgewiesenen Migranten klopfe „Christus selbst an die Türen der Gemeinschaft.“ Kein Wort über die mit der unkontrollierten Massen-Migration verbundene Explosion von Gewaltverbrechen.
Leo XIV.: „Der Kontakt mit denen, die keine Macht und kein Ansehen haben, ist eine grundlegende Form der Begegnung mit dem Herrn der Geschichte. In den Armen hat er uns auch weiterhin noch etwas zu sagen. (…) Ich bin überzeugt, dass die vorrangige Option für die Armen eine außerordentliche Erneuerung sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft bewirkt, wenn wir dazu fähig sind, uns von unserer Selbstbezogenheit zu befreien und auf ihren Schrei zu hören.“ Leo XIV. fällt wie sein heuchlerischer Vorgänger Franziskus in das klassenkämpferische Vokabular der vom polnischen Papst Johannes Paul II. (1978-2005) verurteilten „Befreiungstheologie“, wenn er fordert: „Die Strukturen der Ungerechtigkeit müssen mit der Kraft des Guten erkannt und zerstört werden.“ Es ist bekannt, wie leicht die von der „Befreiungstheologie“ eingeforderte „soziale Gerechtigkeit“ bei einfachen Menschen leicht in den von der katholischen Kirche eigentlich als Todsünde verurteilten Neid umschlägt, der Leistungsträger zu Hassobjekten macht.
Einige Passagen des Lehrschreibens grenzen an einen Armen-Kult und wirken wie eine woke Neuauflage des Prolet-Kultes unseligen Angedenkens: „Die Armen sind in äußerst unsicheren Verhältnissen aufgewachsen, haben gelernt, unter widrigsten Umständen zu überleben, sie vertrauen auf Gott in der Gewissheit, dass niemand sonst sie ernst nimmt, sie helfen sich gegenseitig in den dunkelsten Stunden und haben auf diese Weise vieles gelernt, was sie im Geheimnis ihres Herzens bewahren. Diejenigen unter uns, die keine solchen Grenzerfahrungen in ihrem Leben gemacht habe, können sicherlich viel aus jener Quelle der Weisheit schöpfen, die die Erfahrung der Armen darstellt. Nur wenn wir unser Klagen mit ihren Leiden und Entbehrungen in Beziehung setzen, können wir eine Ermahnung vernehmen, die uns dazu nahelegt, unser Leben einfacher zu gestalten.“
Da ist der Sprung nicht weit zur so genannten Klimapolitik, die die Menschen durch die massive künstliche Verteuerung der Lebenshaltung durch CO2-Steuern und das Billionengrab „Energiewende“ zwingt, ihren Gürtel enger zu schnallen und das über die kartellierten Massenmedien zu einem Gewinn an Lebensqualität verklärt. Für die „Klimarettung“ erscheint kein Opfer übertrieben. Das Thema „Klima“ wird in dem Schreiben zwar nicht direkt angesprochen. Doch hat Leo XIV. erkennen lassen, dass er in dieser Frage ohne Abstriche die bei einem zwar kleinen, aber bedeutenden Teil des Kirchenvolks umstrittene Haltung seines Amtsvorgängers Franziskus teilt. Kurz bevor sein erstes Lehrschreiben publik wurde, hat er sich mit anderen Würdeträgern und ausgewählten Gläubigen versammelt, um vor einem Eisblock aus der angeblich wegschmelzenden Antarktis zu beten. Dabei wurde in diesem Jahr gemeldet, dass das Gewicht des Antarktis-Eises um viele Milliarden Tonnen angewachsen ist.
Beispiele für die produktive Lösung sozialer Probleme
Wer soll den Armen helfen, wenn es keine Reichen gibt? Im päpstlichen Schreiben findet sich auf diese Frage keine Antwort. Die Alternative zu dem von Leo XIV. gepredigten Herz-Jesu-Kommunismus kann sicher nicht darin bestehen, die Armen und insbesondere Alte und Kranke mit einem Almosen abzuspeisen und sie ansonsten ihrem Schicksal zu überlassen. Es gibt aber Formen der Caritas, die im Einklang mit den Interessen von Wohlhabenden stehen. Ein noch immer aktuelles Beispiel dafür aus der Geschichte des Christentums ist die Einrichtung der „Hospices de Beaune“ in der „Weinhauptstadt“ Burgunds im 15. Jahrhundert. Dieses Hospital und Altenheim wurde und wird noch heute finanziert durch Geld- und Land-Schenkungen reicher Landsleute sowie insbesondere durch die Erlöse der hier jährlich stattfindenden Versteigerungen der edelsten Burgunderweine, die Interessenten aus ganz Europa anlocken. So kam und kommt noch heute die Befriedigung der Luxus-Bedürfnisse von Reichen den Kranken und Notleidenden zugute. Demgegenüber macht die „Klimapolitik“, abgesehen von einer kleinen Minderheit politisch korrekter Investoren, fast alle ärmer.
In der zweitausendjährigen Geschichte der katholischen Kirche gibt es weitere Beispiele der einvernehmlichen und produktiven Lösung sozialer Probleme. Nicht immer beruhten diese wie in Beaune auf Freiwilligkeit. Bei der Suche nach Wohlstand mehrenden Problemlösungen taten sich vor allem die Avignon-Päpste hervor. Deren Leistungen sind im deutschen Sprachraum noch immer wenig bekannt. Deshalb konnte sich hier die vom Soziologen Max Weber in die Welt gesetzte Legende verbreiten, wonach die wirtschaftliche Freiheit des Kapitalismus eine Frucht des Protestantismus sein soll. Die historischen Tatsachen widersprechen dieser Sicht.
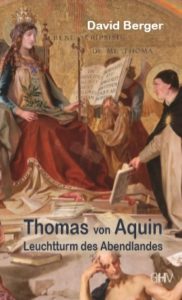 Unter dem zweiten Avignon-Papst Johannes XXII. (1316–1334) erfolgte nicht nur die Heiligsprechung des großen Kirchenlehrers Thomas von Aquin (1225-1274), sondern auch die Abgrenzung von der von den Jüngern des heiligen Franz von Assisi (1181-1226) gepredigten protokommunistischen Glorifizierung der Armut, das heißt in Ansätzen eine Klärung des natürlichen Grundrechtes auf Eigentum. (Nicht zufällig haben Avignon-Päpste auch für den Aufschwung des Weinbaus in Burgund gesorgt.) Doch die Anerkennung des Eigentumsrechts reichte nicht hin, um den Weg zum Wohlstand in einer kapitalistischen Marktwirtschaft freizumachen. Ihr stand als gewichtiges Hindernis das Zins- bzw. Wucherverbot der Kirche entgegen. Dieses Verbot wirkte umso abschreckender, als die Kirche bis ins 12. Jahrhundert aufgrund ihres streng dualistischen Weltbildes noch nicht zwischen Todsünden und lässlichen Sünden unterschied. Es gab also keine Verhältnismäßigkeit zwischen der Schwere eines Vergehens und der drohenden Strafe. Wer einem Reisenden den Schädel einschlug, um ihn auszurauben, den erwartete die gleiche Höchststrafe, die ewige Verdammnis, wie jemandem, der seinen Geschäftspartner lediglich geschickt übers Ohr gehauen hatte. Wer seiner Nachbarin nur lüstern hinterher schaute, war ebenso reif für die Hölle, wie wenn er gleich mit ihr ins Bett gegangen wäre.
Unter dem zweiten Avignon-Papst Johannes XXII. (1316–1334) erfolgte nicht nur die Heiligsprechung des großen Kirchenlehrers Thomas von Aquin (1225-1274), sondern auch die Abgrenzung von der von den Jüngern des heiligen Franz von Assisi (1181-1226) gepredigten protokommunistischen Glorifizierung der Armut, das heißt in Ansätzen eine Klärung des natürlichen Grundrechtes auf Eigentum. (Nicht zufällig haben Avignon-Päpste auch für den Aufschwung des Weinbaus in Burgund gesorgt.) Doch die Anerkennung des Eigentumsrechts reichte nicht hin, um den Weg zum Wohlstand in einer kapitalistischen Marktwirtschaft freizumachen. Ihr stand als gewichtiges Hindernis das Zins- bzw. Wucherverbot der Kirche entgegen. Dieses Verbot wirkte umso abschreckender, als die Kirche bis ins 12. Jahrhundert aufgrund ihres streng dualistischen Weltbildes noch nicht zwischen Todsünden und lässlichen Sünden unterschied. Es gab also keine Verhältnismäßigkeit zwischen der Schwere eines Vergehens und der drohenden Strafe. Wer einem Reisenden den Schädel einschlug, um ihn auszurauben, den erwartete die gleiche Höchststrafe, die ewige Verdammnis, wie jemandem, der seinen Geschäftspartner lediglich geschickt übers Ohr gehauen hatte. Wer seiner Nachbarin nur lüstern hinterher schaute, war ebenso reif für die Hölle, wie wenn er gleich mit ihr ins Bett gegangen wäre.
Von der Erfindung des Fegefeuers zur kapitalistischen Marktwirtschaft
Um Abstufungen in der Schwere von Verfehlungen möglich zu machen, musste es zwischen Himmel und Hölle eine weitere Instanz geben, das Purgatorium (auf Deutsch etwas unglücklich mit Fegefeuer übersetzt). Dieses winkte kleinen Sündern, die obzwar im Stande der Gnade verstorben, noch eine Reststrafe zu verbüßen hatten, bevor sie Gott von Angesicht zu Angesicht schauen durften. Zwar gab es schon bei den Kirchenvätern der Spätantike wie Tertullian, Origenes und Augustinus von Hippo sowie später bei Papst Gregor dem Großen Hinweise auf eine solche Instanz, aber der Begriff „Purgatorium“ taucht, wie der französische Historiker Jacques Le Goff (1981) nachgewiesen hat, erst im Jahre 1133 bei Hildebert von Lavardin, dem damaligen Erzbischof von Tours auf. Und erst gegen Ende des 12. Jahrhunderts findet der Begriff Eingang in den Sprachschatz der lateinisch sprechenden Pariser Intelligenzia. (Der längere Zeit in Paris lehrende Thomas von Aquin sprach wahrscheinlich kein Wort Französisch.) Als offizieller Bestandteil der Lehre der katholischen Kirche anerkannt wurde das Purgatorium schließlich im Jahre 1274, dem Todesjahr Thomas von Aquins, auf dem 2. Konzil von Lyon und später in der Bulle „Benedictus Deus“ des Avignon-Papstes Benedikt XII (1334–1342).
Thomas von Aquin predigte unter dem Einfluss des Platonismus zwar die Orientierung am „Gemeinwohl“, plädierte in seinem Hauptwerk „Summa theologiae“ mit seiner Theorie des „ordo amoris“ jedoch für eine Begrenzung der Solidarität: „Wir können nicht jedem Gutes tun. Daher sagt der heilige Augustinus, dass wir alle zu lieben verpflichtet sind, aber nicht gehalten sind, allen Gutes zu tun. Vor allen anderen müssen wir denen Gutes tun, die uns näherstehen,…“
Wichtiger Bestandteil der Lehre vom Purgatorium war die Annahme, dass die Menschen durch Beten und (freiwillige!) Werke der Nächstenliebe die Qualen der Reinigung für sich selbst und andere abkürzen konnten. Dieser Glaube wurde später zur Basis für die Kapitalbildung durch einen florierenden Ablasshandel. Das mit der Lehre vom Fegefeuer eingeführte Prinzip der Verhältnismäßigkeit erlaubte es gleichzeitig, das Zinsverbot zu umgehen, denn Wucher galt danach allenfalls als lässliche Sünde. Der Zins wurde von nun an vielmehr als Preis für das von den Gläubigern eingegangene Risiko beziehungsweise als Entschädigung für entgangene Gewinnmöglichkeiten begriffen. Es ist sicher kein Zufall, dass der erste Versicherungsvertrag aus dieser Zeit (1287) überliefert ist. Für meinen 2022 verstorbenen libertären Freund Philippe Simonnot stand es deshalb außer Zweifel: Es war die Erfindung des Fegefeuers, die dem Kapitalismus den Weg gebahnt hat. Die protestantische Ethik kann nicht ausschlaggebend für das Aufkommen des Kapitalismus gewesen sein, zumal Luther nach anfänglicher Zustimmung die Lehre vom Fegefeuer als Teufelswerk abgelehnt hat. Dem widerspricht auf den ersten Blick die Beobachtung, dass sich der Kapitalismus später in protestantischen Regionen viel besser entwickelte als in römisch-katholischen. Es geht hier aber um den nachhaltigen geistigen Einfluss von Religionen auf die Gestaltung des Mensch-Umwelt-Verhältnisses.
Auf dem Weg zur Grünen Ökumene
Die katholische Kirche und ihr damaliges Oberhaupt Carol Wojtyla (Johannes Paul II.) spielten eine Schlüsselrolle bei der Etablierung und Verbreitung der globalistischen Klima-Religion. Schon im Jahr seiner spektakulärer Polenreise im Jahre 1979, die Millionen der unter kommunistischer Herrschaft ihrem katholischen Glauben treu gebliebenen Polen anzog, erklärte Wojtyla den heiligen Franz von Assisi zum Schutzpatron aller Umwelt- und Klimaschützer. Ende Oktober 1986 nahm er zusammen mit dem damaligen WWF-Präsidenten Prinz Philip anlässlich des 25. Gründungstages des WWF am Grab des heiligen Franz von Assisi am Treffen der Weltreligionen teil. Ein weiterer Meilenstein auf dem Wege zur grünen Ökumene war Johannes Pauls Neujahrsbotschaft von 1990, in der er die Katholiken aufrief, ihrer „Verantwortung für die Schöpfung“ gerecht zu werden. Somit leistete er neben der löblichen Rehabilitierung der Marktwirtschaft einen wichtigen, wenn nicht entscheidenden Beitrag zum Aufkommen einer grünen Ökumene.
Die Beschäftigung mit den theologischen Hintergründen der Klima-Ideologie ist also alles andere als ein Luxus. Der historische Überblick zeigt, dass die weltweit noch immer einflussreiche, wenn nicht maßgebliche römisch-katholische Kirche, wäre sie dem überragenden Kirchenlehrer Thomas von Aquin und dem von diesem stark beeinflussten Konzil von Trient (1545-1563) treu geblieben, heute die Opposition gegen die selbstmörderische Klimareligion anführen müsste. Stattdessen breiten sich in der katholischen Kirche (wie auch bei der protestantischen Konkurrenz) seit dem 2. Vatikanischen Konzil (1962-1965) starke häretische Strömungen aus, die seit den 80er Jahren Schritt für Schritt in der Klimareligion münden, die den wichtigsten Pflanzennährstoff (CO2) zum Schadstoff erklärt.
Joseph Ratzingers Warnung vor dem „Antichrist“

Chancen für ein Anknüpfen an den besten Traditionen des Katholizismus bot das Pontifikat des deutschen Top-Theologen Joseph Ratzinger, der den Stuhl Petri als Papst Benedikt XVI. von April 2005 bis zu seinem Amtsverzicht Ende Februar 2013 innehatte. Doch Ratzinger hat sich nie mit dem Thema „Klima“ eingehender beschäftigt. Dafür sagte er Erhellendes über die Illusion einer „global governance“. Benedikt XVI. konnte als Augustinus-Kenner wohl nicht darüber hinwegsehen, dass es sich bei der Klima-Religion mit ihrer Verteufelung des Kohlenstoffdioxids im Kern um eine Form des materialistischen Manichäismus handelt, der dem Wesen des Christentums fundamental widerspricht. Die von einem Teil der Klima-Bewegung verfochtene These von der Gleichberechtigung aller Lebewesen steht in absolutem Gegensatz zur christlichen Lehre von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Das auch von weniger radikalen Mitgliedern der Bewegung verfochtene Ziel einer globalen „Kohlenstoffgerechtigkeit“ widerspricht dem Subsidiaritätsprinzip der katholischen Soziallehre und der dahinterstehende Machbarkeitswahn verträgt sich nicht mit dem christlichen Primat des Empfangens vor dem Machen. Ratzinger wandte sich schon 1968 in seiner „Einführung in das Christentum“ gegen eine Politische Theologie, die eine selbst ernannte „Elite“ dazu verleiten könnte, im Namen des Primats des Machbaren gegenüber dem Gemachten sich zum Gott zu erheben. Die Menschen könnten ihre Lebensressourcen „Liebe“ und „Sinn“ nicht selbst kreieren, sondern nur empfangen, mahnte Ratzinger demgegenüber. Außerdem machte er deutlich: Wer immer nur rechnet, ist ein Pharisäer, aber kein Christ.
In seinem dreibändigen Werk „Jesus von Nazareth“ (Freiburg, 2007 ff.) wiederholte Joseph Ratzinger die Warnung, Gott zu spielen, in noch eindringlicheren Worten. Auf Seite 70 legt er zwischen den Zeilen sogar nahe, in der 1992 in Rio beschlossenen „Agenda 21“ ein Manifest des „Antichrist“ zu sehen. Jedenfalls implizieren seine Ausführungen gegen eine durchorganisierte Welt meines Erachtens die Ablehnung einer globalen „Klimapolitik“ nach dem Muster des Kyoto-Protokolls von 1997 und des Pariser Klima-Abkommens von 2015. Denn diese Politik läuft auf den größenwahnsinnigen Versuch hinaus, mithilfe einer künstlichen Verteuerung der Energie eine im Detail chaotische und daher nicht vorhersehbare zyklische Entwicklung in den Griff zu bekommen. All das findet sich ausführlich in meinem Buch „Öko-Nihilismus“ (2012) und soll hier nicht wiederholt werden.
Joseph Ratzingers Warnungen vor dem „Antichrist“ wurden inzwischen von US-Vizepräsident J.D. Vance und dessen Mentor Peter Thiel aufgegriffen. Unser neue Papst Leo XIV. wird sich daran messen lassen müssen, wieweit er bereit ist, der Spur seines Vorgängers Benedikt XVI. zu folgen.
Der Beitrag erschien zuerst auf der absolut empfehlenswerten Seite EIKE-KLIMA-ENERGIE.
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.









Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.