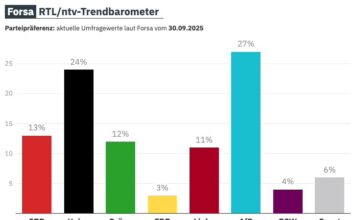Beitrag eines „Achtundsechzigers“ zur Debatte über Leitkultur
Deutschland hat mal wieder eine Diskussion über Leitkultur, die Lothar de Maiziere, unser CDU-Innenminister, mit seinem Verhaltenskatalog an „ungeschriebenen Regeln des Zusammenlebens“ neu eröffnete. An den Anfang stellte er die Frage, wer wir sind und wer wir sein wollen, und hat mit seinen Antworten viel Zuspruch, aber auch viel Ablehnung erfahren. Auf der Seite der Ablehnungsfront gibt es Leute wie den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, die diese Diskussion gerne mit dem Hinweis auf die Verbindlichkeit des Grundgesetzes beenden würden.
Doch ehe man Verhaltensformen oder Verfassungsvorschriften als vermeintliche Merkmale unserer Leitkultur benennt, wäre es hilfreich, wenn man sich erst einmal Gedanken über die Kultur einer Nation machte. Da für die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Özoguz, eine deutsche Kultur – von Sprache abgesehen – „schlicht nicht identifizierbar“ ist, könnte sie ebenso wie andere ein paar Identifizierungshilfen gebrauchen. Ein Debattenbeitrag von Herwig Schafberg
Zur Kultur einer Nation gehören im wesentlichen A) die Sprache, B) die Sitten sowie Bräuche und C) die Geschichte.
Als ich in den Kommentarbereichen einiger Zeitungen auf Facebook diese Kriterien zur Definition von Leitkultur vorschlug, gab es eine Menge Zustimmung, aber auch manchen Widerspruch und in dem Zusammenhang den Vorwurf des „Rassismus“, der heute leichtfertigerweise zur Diskreditierung Andersdenkender üblich ist.
Ein Diskutant wollte sogar auf die Barrikaden gehen, um zu verhindern, daß Leute wie ich sich mit ihren Ideen von Leitkultur durchsetzen; denn die hätte schon einmal das Land ins Verderben geführt. Wenn das eine Anspielung auf die „Rassenpolitik“ der Nationalsozialisten war, wäre es an der Zeit, ihm und seinen Gleichgesinnten beizubringen, daß Hitler und seine willigen Vollstrecker anderen Menschen ebenso wenig wie ich deutsche Kultur aufzwingen, sondern – im Gegenteil – Menschen, die nicht „germanischen Blutes“ waren, davon ausgrenzen wollten. Und dafür trete ich gewiß nicht ein. Doch Frau Özoguz sorgt sich, daß man den Einwanderern eine Leitkultur verordnen oder sie davon ausgrenzen könnte, und findet, daß jede Debatte über Leitkulturinhalte „ins Lächerliche“ abgleite und Vorschläge „zum Klischee des Deutschseins“ verkommen müßten.
Menschen, „die schon länger in diesem Land leben“, wie die Bundeskanzlerin es ungenau formulierte, werden von Cem Özdemir und anderen multikulturellen Träumern als „Biodeutsche“ bezeichnet. Egal, ob sie das abfällig meinen oder nicht, ist es eine Bezeichnung, die im Kern den gleichen rassistischen Inhalt hat wie das, was die Nationalsozialisten unter Menschen „germanischen Blutes“ verstanden. Ich bin jedenfalls kein „Biodeutscher“, Herr Özdemir, und auch nicht „germanischen Blutes“, sondern ein Angehöriger der deutschen Kulturnation, A) deren Sprache ich als meine eigene erlernte und hoch zu schätzen weiß, B) deren Sitten und Bräuche mir zu eigen sind, soweit sie mir lieb und nicht lästig sind, C) deren Geschichte mit all den Umbrüchen und Kontinuitäten Verantwortung mit sich gebracht hat, der ich mich als Mitglied der nationalen Verantwortungsgemeinschaft verpflichtet fühle – einerlei, ob Frau Özoguz sich damit identifiziert oder nicht.
Mit meiner Auffassung von Kulturnation sollte ich in die „rechte Ecke“ zurückgehen, in der ich sie gefunden hätte, empfahl mir ein anderer Diskutant. Ich weiß nicht, welche Ecke für ihn links oder rechts ist; doch ich weiß, daß ich mich nicht etwa auf Hitler berufe, sondern auf Stalin; denn die Kriterien für meine Auffassung hatte ich einst in Josef Stalins Schrift über die Nationalitätenfrage gefunden. Ich bin gewiß nicht davon begeistert, wie der sowjetische Diktator in der politischen Praxis generell mit Menschen und speziell mit Nationalitäten umging; doch was er in der Theorie (!) an Kriterien für die Kultur einer Nation herausfand, halte ich für schlüssig, Frau Özoguz.
A) Daß mehrsprachige Länder wie die Schweiz existieren, ändert nichts daran, daß es in nahezu jedem Land oder Landesteil eine Amts- und Verkehrssprache gibt, in der die Landsleute sich verständigen können sollten, wenn sie in der Schule mit und beruflich voran kommen möchten.
Es ist noch gar nicht so lange her, daß es vor allem in den Reihen der Grünen streng verpönt war, von Einwanderern Integrationsleistungen zu fordern. Und als um 2000 Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, im Rahmen der damaligen Diskussion über Leitkultur verpflichtende Sprachkurse für Einwanderer forderte, wurde ihm das als Versuch einer „Zwangsgermanisierung“ vorgeworfen. Doch seitdem auch Multikultiträumer nicht mehr so grün hinter den Ohren sind, hat sich überall im politischen Establishment die Einsicht durchgesetzt, daß eine Verpflichtung zum Erlernen der Landessprache kein Assimilationszwang ist, sondern eine Integrationshilfe.
Sozioökonomische und soziokulturelle Entwicklungsmöglichkeiten sind eng miteinander verknüpft. Wenn etwa russische Juden nach Deutschland kommen, kann man damit rechnen, daß die meisten von sich aus die deutsche Sprache lernen und ihre Kinder sich großenteils mit guten Leistungen für ein Hochschulstudium oder eine Berufsausbildung qualifizieren; denn Bildung hat für Juden stets eine wichtige Rolle gespielt, weil ihnen das, was sie im Kopf hatten, niemand nehmen konnte, wenn man sie irgendwo vertreiben wollte. Wenn jedoch beispielsweise hier geborene Türken mit Importbräuten aus den bildungsfernen Bevölkerungsschichten Anatoliens verheiratet werden, kann man nicht davon ausgehen, daß diese gesellschaftlich isoliert lebenden Frauen die Landessprache gründlich lernen und qualifiziert sind, ihren Kindern Deutsch beizubringen sowie bei den Schulaufgaben zu helfen und auf das Berufsleben vorzubereiten.
In der Hinsicht versäumten die politisch Verantwortlichen es viel zu lange, durch Fordern und Fördern Abhilfe zu schaffen, Herr de Maiziere und Frau Özoguz. Daß vorschulische Spracherziehung nunmehr gefördert wird, ist ein erfolgversprechender Schritt zur Überwindung von Integrationshindernissen; er reicht jedoch nicht aus, wie vor allem die hohe Zahl junger Männer mit Migrationshintergrund zeigt, die ohne Abschluß die Schule verlassen, obwohl die Leistungsanforderungen immer weiter reduziert wurden. Letzteres hat wiederum dazu beigetragen, daß es auch unter Schulabgängern mit Abschluß immer mehr Halbanalphabeten gibt, die nicht die erforderlichen Voraussetzungen für eine berufliche Qualifizierung mitbringen und ohne Arbeit bleiben.
Wir haben heute schon das Problem, daß die Zahl der Leistungsempfänger die der Leistungsträger übersteigt. Und dieses Problem nimmt weiter zu, solange im Durchschnitt 80 000 hoch qualifizierte junge Deutsche pro Jahr unser Land verlassen und wir es auf der anderen Seite Jahr für Jahr mit ein paar hunderttausend Einwanderern – allein 2015 mehr als 800 000 – zu tun bekommen. Da diese zum größten Teil ohne geeignete Ausbildung sind, wird man eine Riesenmenge Zeit, Geld und Energie in ihre Qualifizierung investieren müssen. Bevor man jedoch dazu ansetzen kann, muß erst einmal dafür gesorgt werden, daß sie die deutsche Sprache lernen.
Sprachgrenzen sind auch Kulturgrenzen. Und wer die Überwindung von Sprachgrenzen im Interesse der Integration für unerläßlich hält und sie zu einer leitenden Maxime der Integrationspolitik macht, der will Einwanderer logischerweise an unsere Kultur heranführen, die insofern zur Leitkultur wird – einerlei, ob diese beim Namen genannt oder mit anderen Worten umschrieben wird, Frau Özoguz.
B) Aus Sitten einer nationalen Gemeinschaft oder einer anderen Bevölkerungsgruppe werden Konventionen zur Regelung von Umgangs- sowie anderen Bräuchen, die zu Konflikten führen können, wenn Sitten und Bräuche unterschiedlicher Kulturen aneinander geraten.
Es reicht nicht, Vokabeln sowie Grammatik der deutschen Sprache so weit zu lernen, daß man in ganzen Sätzen sprechen und schreiben kann, um hier gesellschaftlich und kulturell integriert zu sein. Wenn es um die Integration von Einwanderern aus anderen Kulturkreisen geht, ist es nicht nur wichtig, darauf zu achten, wie von ihnen Gedanken in Worte gefaßt werden, sondern auch, wie diese im Geiste verfaßt sind; denn das sagt manches aus über die Befindlichkeit und Einstellung des Menschen, der sich zu Wort meldet.
Es geht hier besonders um die Mentalität von Menschen, die beispielsweise „Respekt“ nicht etwa als Synonym für „Achtung“ verstehen, sondern für „Furcht“ oder „Ehrfurcht“ und „Ehre“ für etwas halten, das weder dem Geist unserer Verfassung noch dem in unserer Gesellschaft obwaltenden Zeitgeist entspricht; denn Frauen und Kinder sollen bei uns nicht mehr als Sache der Familienehre begriffen und nach altem Brauch so behandelt werden, sondern jeweils als Person geehrt und in der Entwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit gefördert werden.
Während die Hegemonie des Mannes im allgemeinen und des Ehemannes sowie Vaters im besonderen bei uns im Laufe der letzten Jahrzehnte zum Auslaufmodell geworden ist und man sich allgemein (!) darauf verständigt hat, daß weder Ehefrauen bevormundet noch Kinder gezüchtigt werden sollen, ist diese Hegemonie in den muslimischen Milieus immer noch weitgehend unangefochten und wird recht autoritär durchgesetzt – nicht bloß von Ehemännern und Vätern, sondern ebenso von willigen Helfern in Gestalt von Söhnen bzw. Brüdern, die aus Überzeugung oder aus Gehorsamkeit daran mitwirken, jüngeren und weiblichen Familienmitglieder Verhaltensregeln ihres althergebrachten Sittenkodex aufzuzwingen – einerlei, ob dieser dem Grundgesetz und darauf basierendem Recht übereinstimmt oder nicht.
Man hat es in den Reihen muslimischer Einwanderer mit Sippen zu tun, in denen es alter Brauch ist, für heranwachsende Kinder – ohne Rücksicht auf deren Wünsche – Ehen zu arrangieren und über der „Tugend“ der Töchter bzw. Schwestern streng zu wachen, damit diese keine „Schande“ über die Sippe bringen. Ich weiß aus jahrzehntelangem Umgang mit Türken und Arabern, wie unangenehm es vielen von diesen Männern war, die Rolle eines Tugendwächters zu spielen; doch sie spielten zumeist mit, weil es von ihnen erwartet wurde – teilweise sogar von den überwachten Schwestern- und sie nicht für vermeintliche Schwächlinge gehalten werden wollten.
Solange solche „tugendhaften“ Mädchen sich aus freien Stücken auf eine arrangierte Eheschließung einlassen und auch nicht gezwungen werden, beispielsweise ein Kopftuch zu tragen, ist das akzeptabel. Es ist jedoch inakzeptabel, wenn mit dem Brauch des Kopftuchtragens nicht nur demonstriert werden soll, daß sie „sittsame“ Mädchen sind, sondern im Umkehrschluß alle Frauen, die ihre „Reize“ zeigen, für „unanständig“ gehalten und geringschätzig behandelt werden. „Zieh` Dir einen BH an; er stört mich, wie Du ´rum läufst,“ rief ein Türke in Berlin-Kreuzberg einer fremden Frau hinterher, als ob Frauen die Aufgabe hätten, Männern wie ihm zu gefallen. Zufällig war es eine Journalistin, die er maßregeln wollte und die in einem Beitrag für die multikulturell, aber auch feministisch ausgerichtete Taz empört klarstellte, daß in unserer Kultur die Bekleidungsbräuche von Frauen allein deren Sache wäre und Männer gleich welcher Herkunft (!) das zu respektieren hätten.
Neuere Untersuchungen zeigen, daß immer mehr junge in muslimischen Milieus sozialisierte Männer darauf achten, was nach den islamischen Gesetzen angeblich „halal“ (erlaubt) oder „haram“ (verboten) ist und was Muslime demgemäß tun dürfen oder unterlassen sollen. Sie maßen sich nicht bloß ihren Geschwistern, sondern auch anderen Menschen gegenüber eine Anleitungsposition an, die ihnen im beruflichen Alltag voraussichtlich versagt bleibt, wie viele von ihnen vermutlich ahnen.
Nach dem Dafürhalten solcher Jünglinge und deren geistiger Väter in Moscheen und im Internet ist es nicht bloß „haram“, daß eine Muslima sich wie eine deutsche „Schlampe“ kleidet, sondern auch, daß viele Muslime sich mit „Ungläubigen“ angefreundet haben und – schon allein wegen ihrer Kinder – „christliche“ Feste wie Weihnachten und Ostern feiern. Tatsächlich handelt es sich um Volksfeste, an denen zwar die einen nach christlicher Sitte zur Kirche gehen, die meisten aber nach volkstümlichem Brauch lediglich Geschenke am Weihnachtsbaum verteilen und ihre Kinder Ostereier suchen lassen. Doch mancher einheimische Christ oder Nichtchrist, der arglos einem muslimischen Nachbarkind einen Weihnachtsmann oder Osterhasen aus Schokolade schenkt, bekommt es mit entrüsteten Eltern zu tun, die ihre Familie von Bräuchen des deutschen Wirtsvolkes abschirmen wollen und derartige Geschenke zurückweisen, weil diese Entrüsteten Weihnachtsmann und Osterhasen für christliche Symbole halten. Es sei ihnen unbenommen, sich abzugrenzen; doch für die Kinder ist es schade.
Wie in vielen christlichen, muslimischen sowie anderen nichtchristlichen Familien werden auch im ethnisch sowie religiös „gemischten“ Kindergarten meines Enkels die Feste gefeiert, wie sie fallen. Dort gibt es nicht bloß Kindergärtnerinnen unterschiedlicher Herkunft und Religion mit sowie ohne Kopftuch, sondern auch einen türkischstämmigen Betreuer, der mit den kleinen Kindern spielt, sie auf den Topf setzt, wäscht wie auch wickelt und insofern manches tut, was man vor einiger Zeit auch in unserer Kultur noch für eine reine Frauenarbeit hielt und was bis heute von vielen Einwanderern aus dem muslimischen Kulturkreis für eines Mannes unwürdig gehalten wird. Das ist ein tradiertes Bild von Männlichkeit, das keinen Platz hat im Sittengemälde der neuen emanzipatorischen Leitkultur dieses sowie anderer europäischer Länder, zu der auch das Gebilde paßt, das als Gender Mainstream bezeichnet wird.
C) Wer nicht bloß die deutsche Staatsangehörigkeit haben, sondern auch der deutschen Nation angehören will, ist gut beraten, wenn er – last not least – die nationale Geschichte mit der Zeit als seine eigene zu begreifen und sich demgemäß mit den Deutschen zu identifizieren lernt.
Zur Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gehört jene historische Entwicklung, die um 1968 mit Protesten begann und zur weiteren Liberalisierung von Staat und Gesellschaft in Westdeutschland (inklusive West-Berlin) beitrug: Einerseits durch die Reformpolitik der sozialliberalen Koalition im Bund, andererseits durch Bürgerinitiativen auf lokaler Ebene und darüber hinaus bundesweit durch die Friedens- und die Umweltschutzbewegung, ferner durch die Emanzipationsbewegung von Frauen und Homosexuellen.
Ich will hier nicht über den Vietnamkrieg und weitere Anlässe reden, die vor rund fünfzig Jahren in Deutschland wie in anderen westlichen Ländern zu Protesten von Studenten und anderen Jugendlichen führten, sondern über die Motive und Wirkungen. Und dazu gehört die Empörung, die sich nicht nur gegen die staatliche Obrigkeit, sondern auch gegen andere Autoritäten – in Familie, Schule sowie Hochschule – richtete.
Die antiautoritären Impulse, von denen die Proteste angetrieben wurden, gaben manche positiven Denkanstöße zu politischen Entscheidungsprozessen und bewirkten – abstrakt – eine weitreichende Befreiung der Individualität von gesellschaftlichen Normen in Verbindung mit der Emanzipation von Familienstrukturen und – konkret – den Verzicht auf Prügelpädagogik in der Schule sowie (nicht überall) im Elternhaus, die tendenzielle Erziehung zu einer autonomen (kritikfähigen) Persönlichkeit, die sexuelle Selbstbestimmung, die rechtliche Gleichstellung der Frauen mit den Männern und das Zusammenleben in außerehelichen Wohngemeinschaften. Zugute kam diese Entwicklung vor allem Kindern, Frauen und Homosexuellen beiderlei Geschlechts, obgleich nicht alles, was gut gemeint war, sich letzten Endes als gut erwies.
Diese Entwicklung fand im Laufe der Zeit breite Zustimmung in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, ging jedoch fast völlig vorbei an Einwanderern aus der Türkei, die noch als Gastarbeiter angesehen wurden, als viele von denen schon längst die Familie nachgeholt hatten und den Aufenthalt in diesem Lande ebenso auf Dauer einrichteten wie Immigranten aus dem Bürgerkriegsland Libanon und später aus weiteren Krisengebieten des Orients. Ein großer Teil von den einen sowie den anderen fand die kulturellen Umbrüche, die hier zu erleben waren, schockierend und nistete sich in kolonieartigen Parallelgesellschaften ein, in denen sie ihre Kinder mit autoritären Allüren vor libertären Tendenzen der westlichen Zivilisation bewahren wollten, wie im letzten Kapitel beispielhaft dargestellt wurde
Unterstützt wurde und wird die soziokulturelle Abgrenzung durch Moscheen, in denen vor allem jene Kinder und Kindeskinder muslimischer Einwanderer Halt und Orientierung gefunden haben, denen die Freizügigkeitsverlockungen und Wettbewerbsbedingungen hierzulande Probleme bereiten. Das ist eine Fehlentwicklung, die korrigiert werden muß, um der weiteren Segregation entgegen zu wirken. Walten Sie Ihres Amtes und streiten sich nicht um Begriffe, Herr de Maiziere und Frau Özoguz, die gerne „Leitkultur“ durch „politisches Leitbild“ und „politische Kultur“ ersetzt haben möchte!
„Ich hasse den Islam nicht,“ sagte der niederländische Soziologe und Politiker Pim Fortuyn, der zum Mordopfer jener Hetzer wurde, die jede Kritik am Islam als islamophob sowie rassistisch diffamieren. Er hätte bloß „keine Lust, die Emanzipation von Frauen und Homosexuellen zu wiederholen,“ erklärte Fortuyn, den sehr viele seiner Landsleute wie etwa der aus Marokko stammende sozialdemokratische Bürgermeister von Rotterdam inzwischen für „einen der größten Niederländer aller Zeiten“ halten.
Wiederholen läßt sich Emanzipation nicht, aber nachholen von denen, die an der Entwicklung nicht teilnahmen und in Verhältnissen mit ähnlichen Sitten und Bräuchen leben wie die meisten Deutschen vor 50 Jahren – also auch und vor allem von Einwanderern mit ihren patriarchalisch strukturierten sowie religiös regulierten Formen des Zusammenlebens. Man kann Menschen nicht zwingen, diesen Prozeß nachzuholen, aber dazu einladen und dafür sorgen, daß diejenigen, die zurückbleiben wollen, nicht den Weg versperren.
Nachdem die politisch Verantwortlichen viel zu lange mit Moslemverbänden sowie Moscheevereinen paktiert und nicht zuletzt damit zugelassen hatten, daß diese mehr zur Segregation als zur Integration muslimischer Einwanderer und deren Nachwuchs beitrugen, wäre es eingedenk der zunehmenden Radikalisierung von Jugendlichen aus muslimisch sozialisierten Milieus nötiger denn je, insbesondere die Entwicklung junger Muslime gleich welchen Geschlechts und welcher sexuellen Orientierung zu autonomen Persönlichkeiten zu fördern, Herr de Maiziere und Frau Özoguz! Trauen Sie sich einen solchen Kulturkampf zu?
Dazu gehört, daß Jugendliche ermutigt werden, gegen den Autoritarismus in der realen Gestalt des Abu oder Aba, des Vaters, und der fiktiven Gestalt Allahs, des Übervaters, kritisch aufzubegehren, statt ihre Kritik weiter aggressiv gegen alle zu richten, die anders als sie leben, lieben, denken oder glauben und von ihnen als Feinde ihrer Kultur behandelt werden.
Solche Aggressivität macht sich häufig auch in politischen Diskussionen mit Muslimen bemerkbar. Soweit ich es dabei mit Muslimen zu tun hatte, die sich selbst als Deutsche bezeichneten, aber bei Gesprächen über die Mitwirkung des „Westens“ an Krisen im Nahen und Mittleren Osten (inklusive (deutscher Militärhilfen) mich als Deutschen in der Mitverantwortung sahen, sich aber aus dieser Mitverantwortung heraus und in die Rolle eines Angehörigen der Umma – der „islamischen Nation“ – zurückzogen, vermochte ich sie nicht als Landsleute (an)erkennen – schon gar nicht, wenn es um die historisch begründete Verantwortung für Juden im allgemeinen und Israel im besonderen ging; denn diese Verantwortung gehört zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland und damit zur Leitkultur oder – wie Frau Özoguz es nennen würde – zur politischen Kultur in diesem Bundesstaat.
Es gibt zwar auch viele Einheimische, denen es an Bereitschaft zur Mitverantwortung mangelt; doch sie sehen ein, daß die Ursachen in der deutschen Geschichte liegen, und empfinden sich immerhin als Deutsche davon persönlich tangiert. Das ist eine Empfindung, die man von Immigranten zunächst einfach erwarten kann. Doch wenn ihre Nachkommen in der zweiten, dritten oder gar noch in der vierten Generation immer noch nicht die Geschichte des Landes, in dem sie leben, als ihre eigene begreifen, dann sind sie zu einem wesentlichen Teil Kolonisten aus dem muslimischen Kulturkreis geblieben und nicht zu Angehörigen der deutschen Kulturnation geworden.
Das sei ihnen unbenommen, solange sie das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nicht unter den Vorbehalt der Scharia oder eines anderen Regelwerks stellen; denn das Grundgesetz gehört zu den wichtigsten Resultaten unserer historischen Erfahrungen.
Die Integrationsbeauftragte des Bundes ist der Meinung, daß wir mit Migranten immer wieder auf’s neue Bedingungen des Zusammenlebens aushandeln müßten. Die Bedingungen sind durch das Grundgesetz der Bundesrepublik und darauf basierende Rechtsvorschriften bestimmt. Sie gelten für alle Menschen gleich welcher Herkunft und Religion, welchen Geschlechts sowie welcher sexuellen Orientierung und müssen nicht ausgehandelt werden, Frau Özoguz, sondern sie müssen erfüllt werden, wie sie in Wort und Geist vorgegeben sind.
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.