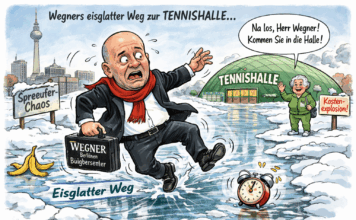Ein Zeitzeuge erinnert sich und erkennt beunruhigende Parallelen zu Heute. Gastbeitrag von Meinrad Müller
Was ich heute sehe, macht mir Angst. Als Kind war ich neun Jahre alt, als der Krieg zu Ende ging. Ich wusste nicht, warum Bomben fielen, ich verstand den Inhalt der Reden aus dem Volksempfänger nicht, aber ich spürte, dass Gewalt in der Luft lag. Ich sah, wie Nachbarn nicht mehr gegrüßt wurden. Ich hörte, wie Erwachsene flüsterten und schwiegen, sobald jemand Fremdes den Raum betrat.
Heute bin ich 89. Ich lebe in einem Zimmer im Altersheim. Die Tage sind ruhig geworden, aber nicht leer. Viele von uns lassen den Fernseher laufen, nicht weil uns das Programm interessiert, sondern weil die Stille im Zimmer uns sonst Angst macht. Man hört dann auch nicht mehr so genau, was auf dem Flur vor sich geht. Es ist, als würde man sich mit dem Geräuschpegel eine Decke über die Ohren ziehen.
Wir alten Menschen lesen auch noch die Zeitung. Meist zuerst die Todesanzeigen, das ist so eine stille Gewohnheit. Man rechnet in Gedanken, wann man selbst an der Reihe ist. Und manchmal erinnern wir uns an früher. Vor achtzig Jahren sagten Opa und Mama: „Du musst die Zeitung lesen. Wenn du draußen mit jemandem redest, ist es gut, das Gleiche gelesen zu haben. Sonst fällst du auf.“ Das war damals gefährlich.
Und ich frage mich: Ist es heute so viel anders? Ich bin einer von über 1,8 Millionen Deutschen, die vor 1940 geboren wurden. Viele von uns hatten nie die Kraft, über das Schreckliche ihrer Jugend zu erzählen. Manches war zu groß für Worte. Und vieles wollten wir den Kindern nicht mitgeben. Sie sollten in einer besseren Welt aufwachsen. Das war unsere stille Hoffnung.
Ich erinnere mich, wie es war, wenn ein Haus, in dem ein Freund vor einer Stunde noch Geigen spielen lernte, durch eine Bombe in Stücke gerissen wurde. Wer es nicht rechtzeitig in den Keller schaffte, lag tot oder schwer verletzt zwischen zerborstenen Zimmerdecken, zerfetzten Gardinen und verkohlten Balken. Und nach einigen Tagen kam ein süßlich-fauliger Geruch aus den Ruinen unserer Straße. Der Tod war nicht abstrakt. Er lag in der Luft.
Heute liegt keine Asche in der Luft, sondern eine andere Art von Angst.
Worte treffen wieder wie Splitter. Ich höre in den Nachrichten wieder Sätze, die mir Angst machen. Sie fühlen sich an wie Granaten aus Fernsehstudios, Parteizentralen und Redaktionsstuben.
Ich frage mich oft, wie schnell sich Sprache verwandeln kann. Heute heißt es, man müsse die Demokratie verteidigen gegen Andersdenkende, gegen Radikale, gegen jene, die zu viel fragen. Damals hieß es, man müsse das Volk „reinhalten“ und den Gegnern „keinen Raum lassen“. Der Ton ist ein anderer, das Prinzip das gleiche: Wer nicht mitmacht, wird aussortiert.
Ich erinnere mich, wie meine Mutter mit meiner Tante flüsterte, dass der mit dem Schnurrbart uns das eingebrockt habe. Und wie beide schlagartig schwiegen, als die Nachbarin zur Tür hereinkam.
Und hier im Heim ist es nicht anders. Wenn ich mit anderen spreche, vorsichtig, beim Frühstück oder auf dem Flur, höre ich Sätze wie:
„Sagen Sie das lieber nicht so laut.“„Die Pflegerinnen sind alle auf Linie. Das ist heute so.“
Wir alten Leute sind hilfsbedürftig, abhängig, oft allein und haben gelernt, uns wieder klein zu machen. Nicht aus Feigheit, sondern weil wir nicht auffallen wollen. Nicht dass die Schwester beim Waschen die Stirn runzelt, wenn wir die falsche Meinung haben. Und ich spüre: Auch sie, die uns pflegen, glauben vielleicht, sie seien auf der richtigen Seite. Aber ich sehe in ihren Augen keinen Zweifel. Nur Routine. Nur den Gleichschritt, den ich schon einmal gesehen habe, vor achtzig Jahren.
Was mir am meisten Angst macht, ist nicht die Lautstärke der Überzeugten, sondern die stille Zustimmung der Angepassten. Damals wie heute marschieren viele nicht aus Überzeugung, sondern weil sie glauben, es sei sicherer so. Man will dazugehören. Man will nicht auffallen. Und gerade deshalb fällt so lange niemandem auf, wie weit man sich schon von der Menschlichkei entfernt hat.
Was mich besonders schmerzt, ist das Unverständnis unserer Kinder und Enkel. Sie meinen es gut. Sie sind freundlich. Sie besuchen uns, wenn es ihre Zeit erlaubt. Doch manchmal höre ich ihre Gespräche und erschrecke. Wie sie sich empören. Wie sie für das „Richtige“ wieder mit Waffen kämpfen wollen. Wie sie kein Verständnis mehr haben für jene, die anders denken.
Ich sage nichts. Nicht, weil ich keine Worte hätte. Im Gegenteil, ich habe Jahrzehnte mit dem Schweigen gelebt. Aber ich will meine Kinder nicht verlieren. Und meine Enkel erst recht nicht.
Ich liebe sie.
Und ich weiß, sie meinen es gut. Doch manchmal wünsche ich mir, sie würden auch uns fragen. Nicht nur dem heutigen Volksempfänger, dem Fernsehen.
Ich möchte niemandem etwas vorwerfen. Ich weiß, wie schwer es ist, in dieser Welt zu stehen und standzuhalten. Aber ich wünsche mir, dass man nicht wieder beginnt, anders Denkende aus dem Beruf, aus dem Gespräch, aus der Gesellschaft zu drängen, nur weil sie eine andere Partei wählen. Damals sagte meine Großmutter. Unsere einzige Partei weiß alles besser.
Will man heute schon wieder eine Partei, die nicht kritisiert werden darf?
Ich hätte nicht gedacht, dass ich das alles noch einmal erleben muss.
Und vielleicht ist das das Letzte, was ich euch sagen möchte: Seid wachsam. Und hört auf jene, die es schon einmal erlebt haben, gerade auch wenn ihre Stimmen leise geworden sind.
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.