Das Beispiel der 1200 Jahre arabisch-islamischer Raub- und Kriegszüge gegen Europa. Gastbeitrag von Hartmut Danneck.
Was im europäischen Bewusstsein heute kaum mehr präsent ist, sind die Jahrhunderte lang sich wiederholenden Aggressionen, Kriegs- und Raubzüge, die „Razzien“ ( von arabisch „gazwa“ = Kriegszug, Raubzug) gegen Europa, von Irland über England, Frankreich, den Alpenraum, Italien bis zum Balkan, Griechenland und Kleinasien.
Aus kurzfristigen, überfallartigen Beutezügen entwickelten sich in etlichen Regionen Eroberungen von Gebieten, die dann zu islamischen Herrschaftsbildungen führten, die Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte bestanden.
Raub, Versklavung, Terror und Islamisierung
Materielle Ziele (Beute, Sklaven) verbanden sich mit machtpolitischen (Gründung islamischer Herrschaftsgebiete) und mit dem religiös motivierten Willen, den Islam, die einzig wahre Religion, zu verbreiten, indem man Furcht in die Herzen der Ungläubigen warf.
Hintergrund war die Lehre, dass zwischen dem Dar al-Islam, dem „Haus des Islams“ und dem „Dar al-Harb“, den „Haus des Kriegs“ der Expansionskrieg der Normalfall sei, der nur gelegentlich durch taktischen Waffenstillstand unterbrochen werde. Wahrer Friede könne nur eintreten, wenn der Feind den Islam oder den Status einen Dhimmis, eines unterworfenen Tributpflichtigen, annehme.
Ab etwa 650 formierten sich arabische Flotten, die zunächst Überfälle auf die byzantinischen Küsten und Inseln im östlichen Mittelmeer unternahmen. Truppen der Umayyaden-Kalifen belagerten wiederholt erfolglos Konstantinopel. Unter den Abbasiden, den Nachfolgern der Umayyaden, erreichten die arabischen Seeüberfälle ab dem 9. Jahrhundert ihren vorläufigen Höhepunkt.
Kreta und Süditalien unter dem Halbmond
Um 824 landeten Muslime aus dem Emirat Cordoba auf dem byzantinischen Kreta. Die Bevölkerung von 29 Städten wurde versklavt. Verheerende Raubzüge in der Ägäis folgten. Die Klöster am Berg Athos wurden mehrfach in Schutt und Asche gelegt. Thessaloniki, die zweite Stadt des Reichs, wurde geplündert und 20.000 Bürger auf die Sklavenmärkte von Kreta verschleppt. Erst 961 gelang Byzanz die Rückeroberung der Insel.
Ab 832 begann die Festsetzung auf Sizilien. Syrakus fiel nach neunmonatiger Belagerung. Tausende wurden umgebracht und es fiel reiche Beute an. 902 wurden die Bewohner von Taormina mit dem Schwert niedergemacht.
Dann setzten die Eindringlinge zum Sprung auf das italienische Festland an. Sie eroberten Tarent und gründeten ein Emirat, plünderten Jahr für Jahr die Städte in Apulien, Kampanien, Kalabrien, in den Abruzzen und besiegten in der Adria eine venezianische Flotte. Tarent wurde zu einem Zentrum des Sklavenhandels. 846 tauchten sie selbst vor Rom auf und plünderten Alt-Sankt-Peter und die Vororte.
Farahsanit, der Schrecken Südfrankreichs und der Westalpen
Farahsanīt, heute La Garde-Freinet östlich von Marseille, war von etwa 887 bis 972 ein Brückenkopf von Muslimen, eine Mischung aus Piratennest und religiös motivierter Militärsiedlung (ribat) von Dschihadisten. Fast ein Jahrhundert lang nutzten die Sarazenen die Schwäche der spätfränkischen Feudalreiche. Die Provence, Burgund, Savoyen, Piemont und Ligurien wurden geplündert und zahlreiche Europäer aus Städten wie Marseille, Toulon oder Aix als Sklaven verschleppt. Die Plünderungen führten zu einer weitgehenden Entstädterung des Küstensaumes von Ligurien und Septimanien.
Die Muslime richteten Razzien auch gegen die Zentralalpen und griffen immer wieder selbst Chur und St. Gallen an. Der Mönch und Geschichtsschreiber Ekkehard IV. beschrieb das Treiben sarazenischer Plünderer in der Ostschweiz und den erbitterten Widerstand St. Galler Mönche im Jahre 939.
Eine gewisse Entlastung für die europäischen Küstenregionen brachten der Niedergang der muslimischen Herrschaft in Spanien, innere Machtkämpfe im muslimischen Bereich und die Kreuzzüge zwischen 1099 und 1291, die arabisch-muslimische Kräfte banden.
Die Barbareskenstaaten – Piraterie unter der Fahne des Propheten
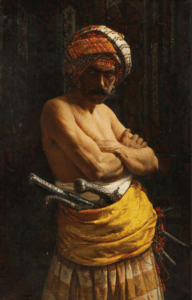
Allerdings nahm die nordafrikanische Piraterie gegen die christliche Seefahrt seit dem 14. Jahrhundert erneut zu. In Algier, Tunis und Tripolis bildeten sich Korsarenstaaten, alle unter lockerer Herrschaft der Osmanen. Unter der Herrschaft von Deys war hier die ganze Wirtschaft auf Beute und Versklavung von Europäern ausgerichtet. Ein Achtel der Beute fiel an den Dey; der Rest wurde zwischen Kapitän bzw. Reeder und der Mannschaft geteilt.
Die Korsaren fuhren meist auf Galeeren mit Sklaven als Ruderern. Vor der Fahrt wurde der Segen eines Marabuts eingeholt, eines islamischen Heiligen, was die religiöse Grundierung der ganzen Aktionen zeigte. Muslimische Quellen rechtfertigten die Korsarenfahrten ausdrücklich als „Dschihad zur See“, als eine heilige Mission im Namen Allahs.
Plünderungszüge betrafen die Mittelmeerküsten, gingen aber auch bis nach Irland und Island. In die Hafenstadt Baltimore an der irischen Südküste fielen algerische Korsaren 1631 ein und verschleppten 100 Bürger in die Sklaverei. Nur drei gelang die Flucht. Baltimore war für Generationen verödet.
Die Opferzahlen waren hoch. Der US-amerikanische Historiker Robert C. Davis kommt allein für den Zeitraum zwischen 1530 und 1640 auf die Zahl von einer Million. Zusammen mit den Opfern islamischer Raubzüge vor und nach diesem Zeitraum ergibt sich eine Zahl von mehreren Millionen Opfern.
In den Sklavengefängnissen, den Bagnos, vegetierten die zusammengepferchten Sklaven, bei schlechter Ernährung und von Ungeziefer geplagt, um tagsüber Zwangsarbeit zu leisten. Von Hunderttausenden und ihrem Leiden und Streben spricht keine Quelle. Nur wenige Glücksfälle wie Miguel des Cervantes und Lorenz von Arreger konnten der Sklaverei entkommen und berichten.
Zwei Beispiele von Versklavten und Entronnenen
 Miguel de Cervantes y Saavedra (Gemälde r. © Luis Alvaz, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons), der später weltberühmt gewordene Autor, hatte in der Seeschlacht bei Lepanto, in der Spanien und andere christliche Staaten die Osmanen besiegten, die linke Hand verloren. Er wurde 1575 vor Katalonien zusammen mit seinem Bruder zum Opfer algerischer Korsaren. Das Empfehlungsschreiben, dass er von seinem Flottenchef erhalten hatte, machte ihn zu einem wertvollen Gefangenen. Doch das von der Familie zusammengekratzte Lösegeld reichte nicht. Fünfmal scheiterten seine Fluchtversuche, doch er blieb ungebeugt. Er wurde 1580 zum Galeerensklaven bestimmt und war bereits an Bord einer Galeere nach Konstantinopel, als es einem Mönch des Trinitarierordens gelang, ihn freizukaufen.
Miguel de Cervantes y Saavedra (Gemälde r. © Luis Alvaz, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons), der später weltberühmt gewordene Autor, hatte in der Seeschlacht bei Lepanto, in der Spanien und andere christliche Staaten die Osmanen besiegten, die linke Hand verloren. Er wurde 1575 vor Katalonien zusammen mit seinem Bruder zum Opfer algerischer Korsaren. Das Empfehlungsschreiben, dass er von seinem Flottenchef erhalten hatte, machte ihn zu einem wertvollen Gefangenen. Doch das von der Familie zusammengekratzte Lösegeld reichte nicht. Fünfmal scheiterten seine Fluchtversuche, doch er blieb ungebeugt. Er wurde 1580 zum Galeerensklaven bestimmt und war bereits an Bord einer Galeere nach Konstantinopel, als es einem Mönch des Trinitarierordens gelang, ihn freizukaufen.
1732 entführten Korsaren den jungen Solothurner Offizier in spanischen Diensten Lorenz von Arreger nach Algier. Der Dey nahm ihn als vermeintlich finanzkräftige Beute in eine milde Haft und forderte 100.000 Piaster Lösegeld. Als das Geld ausblieb, wurde Arreger mit seinem jungen Diener zusammengekettet. Dann wurde er in den Bagno geworfen; ein Kupferring über dem linken Knöchel zeigte ihn als Staatssklaven. Drei Jahre lang musste er mit anderen christlichen Sklaven schwer beladene Steinkarren ziehen und einen Hafendamm aufschütten. Seine Großherzigkeit zeigte Arreger, als er aus eigenem Geld den Loskauf seines (billigeren) Dieners erreichte. Die Rettung kam, als Solothurn Geld bereitstellte und der Orden der Mercedarier ihn zusammen mit 83 weiteren Gefangenen auslösen konnte.
Ritterorden gegen Sklaverei
 Lange Zeit forderte die Bevölkerung der europäischen Küstenregionen vergeblich von ihrer feudalen Obrigkeit Hilfe. Immerhin baute man an vielen Küsten „Sarazenentürme“, Diese Wachttürme standen untereinander in Sichtkontakt, telegrafiert wurde mit Kanonenschüssen oder Feuersignalen. Auf den Sarazenen-Alarm hin flohen die Küstenbewohner ins Hinterland. Allein auf Korsika errichteten die Genueser 150, die Spanier auf Sardinien 70 solcher Türme.
Lange Zeit forderte die Bevölkerung der europäischen Küstenregionen vergeblich von ihrer feudalen Obrigkeit Hilfe. Immerhin baute man an vielen Küsten „Sarazenentürme“, Diese Wachttürme standen untereinander in Sichtkontakt, telegrafiert wurde mit Kanonenschüssen oder Feuersignalen. Auf den Sarazenen-Alarm hin flohen die Küstenbewohner ins Hinterland. Allein auf Korsika errichteten die Genueser 150, die Spanier auf Sardinien 70 solcher Türme.
(Maria als Schutzpatronin des Mercedarierordens – Gemälde von Vicente López y Portaña, ca. 1798)
Schon seit 1198 bestand der Trinitarier-Orden, der sich dem Freikauf und dem Austausch christlicher Gefangener und Sklaven in den Händen der Sarazenen widmete. Er breitete sich von Paris aus über Frankreich, Italien und Spanien aus.
Das gleiche Ziel verfolgte der in Barcelona 1218 gegründete Mercedarierorden. Die Mercedarier sammelten Spenden und kauften auf gefahrvollen Reisen in die Barbareskenstaaten mittellose christliche Sklaven los. Sie verpflichteten sich sogar in ihrem Gelübde, sich selbst als Pfand für Gefangene zu stellen. Ein Beispiel für einen Freikauf war der von 1785, als 313 Gefangene frei kamen.
Das Ende der „weißen Sklaverei“
Viele europäische Staaten, aber auch die USA und selbst die Hansestadt Hamburg, deren Handel schwer geschädigt wurden, kauften sich mit jährlichen Tributzahlungen an die Barbareskenstaaten frei. Allein die jungen USA mussten bis 1800 pro Jahr bis zu einer Million Dollar an Tribut- und Lösegeldzahlungen aufbringen. Das waren 20 Prozent der Staatseinkünfte.
Das begann sich zu ändern, als US-Präsident Jefferson sich 1801 weigerte, auf eine erhöhte, demütigende Tributforderung des Machthabers von Algier einzugehen. Der Dey erklärte daraufhin den USA den Krieg. Die folgende Intervention war so durchschlagend, dass die Barbareskenstaaten und ihr vormodernes Geschäftsmodell ins Wanken kamen. Doch erst die Kolonisierung Algeriens durch Frankreich 1830 machte den Beutezügen und der “weißen Sklaverei“ im Mittelmeer ein definitives Ende. Für woke Zeitgenossen schwer erträglich: Die Kolonisatoren öffneten die Sklavengefängnisse in Algier, befreiten tausende von Sklaven und brachten so gesehen den Fortschritt.
Die „Knabenlese“ der Osmanen
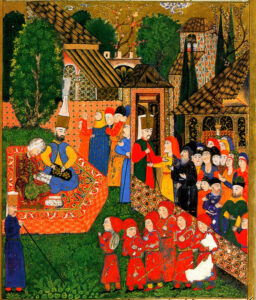
Von Anfang des 14. Jahrhunderts bis Mitte des 17. Jahrhunderts, also über 300 Jahre lang, litten die christlichen, den Osmanen unterworfenen Balkanvölker unter dem Raub vieler ihrer Söhne. Im Zuge der „Devschirme“ („Knabenlese“) mussten immer wieder die griechischen, serbischen, bulgarischen, albanischen usw. Dörfer einen Teil ihrer männlichen Jugendlichen als Tribut an die osmanischen Behörden ausliefern. Die Eintreiber drohten den Familien bei Widersetzlichkeit mit schwersten Strafen bis zur Todesstrafe.
Die unglücklichen Christenjungen wurden zwangsislamisiert und in die Elitetruppe der Janitscharen eingereiht. Sie lebten in Kasernen, Ehen waren ihnen verboten. Sie waren als fanatische, rücksichtslose Glaubenskrieger gefürchtete Gegner der christlichen Truppen. Mit der Zeit entwickelten sie einen exklusiven Korpsgeist und wurden den Sultanen erst durch steigende Ansprüche lästig, dann durch Meutereien und Staatsstreiche gefährlich. Was mit Raub und Versklavung begann, endete 1826 in einem blutigen Massaker in den Straßen Istanbuls: Der Sultan ließ die Janitscharen von loyalen Truppen zusammenschießen.
Imperialer Drang zu den „goldenen Äpfeln“ Europas
Vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert zielten imperiale Träume der Osmanen auf die Eroberung des „Kizil elma“, des roten bzw. goldenen Apfels, worunter man Europa bzw. im Besonderen herausgehobene europäische Städte wie Konstantinopel, Budapest, Rom und Wien verstand. In offiziellen Bilddarstellungen ließen sich zahlreiche Sultane mit dem Goldenen Apfel in der Hand darstellen. Zum Thronbesteigungsritual gehörten die an die Janitscharen gerichteten Worte: „Beim Goldenen Apfel sehen wir uns wieder!“
Als erster „Goldener Apfel“ fiel den Osmanen 1453 Konstantinopel in die Hände; 1521 eroberten sie Belgrad, den „Goldenen Apfel der Ungarn“. Wien, den „Goldenen Apfel der Deutschen“, vermochten sie weder 1529 noch 1683 zu gewinnen.
Die heutige Türkei unter Erdogan versteht sich als Nachfolgerin des Osmanischen Reiches auf dem Balkan und betont ihre Rolle als Regionalmacht. Der Bau von Moscheen ist dabei nur ein Element einer umfassenderen türkischen Infrastrukturpolitik, die weit über den Westbalkan hinausreicht und auch den Kaukasus, Zentralasien, Nordafrika und Teile Subsahara-Afrikas umfasst, wie Rebecca Bryant, Professorin für Kulturanthropologie an der Universität Utrecht, erklärt.
Die These von der ausschließlich „weißen Schuld“ macht schwach und erpressbar
Die meisten der oben dargestellten Fakten sind heutzutage weitgehend aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Dazu beigetragen hat der Einfluss des postkolonialen Denkens, das seit 50 Jahren in Medien, Lehrplänen und Politik zur Herrschaft gelangte. Dieses Denken geht von einer einfachen Schwarzweißkonstruktion aus: der nichtwestlichen Welt, die als schuldloses Opfer, oft sogar nach dem alten Klischee als edel und keiner Untat fähig imaginiert wird, der ein dämonisierter Westen als Quelle allen Unheils entgegengesetzt wird. Rassismus, Unterdrückung, Sklaverei werden ausschließlich dem Westen zugeschrieben. „Diese Engführung lässt sich empirisch nicht halten und ist schlicht abenteuerlich“, so Prof. Susanne Schröter.
Die hier genannten Tatsachen zeigen am Beispiel der arabisch-islamischen Welt, dass all dies dort aus eigener Wurzel gewachsen ist, lange vor der europäischen Kolonisierung und keineswegs als Reaktion darauf. In krasser Form begegnen dort religiös legitimierte Ungleichheit, Entrechtung der Unterworfenen, Sklavenhandel in größerem Stil als im Westen, militärische Expansion und Bereitschaft auch zu Massakern.
„Aber die Kreuzzüge!“ wird dem entgegengehalten. Es stimmt, die 195 Jahre der Kreuzzüge sind kein Ruhmesblatt der europäischen Geschichte. Eine Fülle von Untersuchungen und populären Darstellungen thematisieren dies jedoch. Wo aber ist in den arabisch-muslimischen Ländern die Selbstkritik für die 1200 Jahre muslimischer Kriegs- und Raubzüge gegen Europa, von etwa 650 bis 1830?
Längst ist in der veröffentlichten Meinung hierzulande die berechtigte Selbstkritik in selbst-denunziatorische Kasteiung und Abwertung der eigenen Geschichte und Kultur umgeschlagen. Die Verinnerlichung dieser Fehlhaltung macht aber unsicher, erpressbar und schwach. Das zeigt sich bei jedem Klimagipfel, wenn es um die „Ablasszahlungen“ des Westens an die Potentaten des Südens geht. Das zeigt sich auch bei den Verrenkungen der „Beutegut“-Restitution, wenn deutsche Minister museale Schätze zurückgeben, die dann in die Hände der Nachkommen von veritablen Sklavenhaltern geraten. Ohne die Überwindung dieser Fehlhaltung ist ein gedeihlicher Weg für Europa nicht zu begründen und zu begehen.
*
Hartmut Danneck, geboren 1952, Studium der Germanistik und Geschichte, Oberstudienrat a. D., schrieb einen Beitrag zum Thema Widerstand 1933-1945 (1990), ein Theaterstück über den Hitler-Attentäter Georg Elser (2003), eine Satire über die Einwanderungspolitik nach 2015 (2023) und geschichtliche Jugendbücher (2020, 2022, 2023).
Hier eine Auswahl der Buchveröffentlichungen bei e-publi.
***
PP berichtet an 365 Tagen im Jahr für Sie, bringt die Nachrichten, von denen die Mainstreammedien wollen, dass diese nicht ans Tageslicht kommen. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

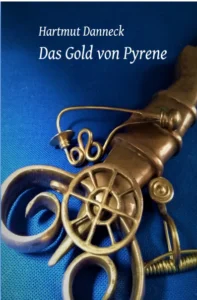








Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.