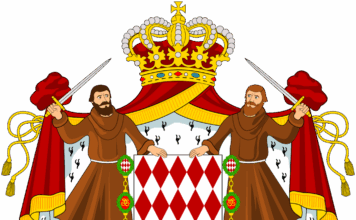Gastbeitrag von Meinrad Müller
Es fing gut an. Wie aus dem Nichts, aber irgendwie vertraut. Ihr Lächeln traf mich, als hätte ich es schon gekannt. Wir redeten, lachten, fanden schnell eine gemeinsame Sprache. Zwei Menschen, beide mit Vergangenheit, aber offen für eine gemeinsame Zukunft. Es fühlte sich leicht an. So, wie man sich das wünscht, wenn man längst nicht mehr Anfang zwanzig, sondern Mitte Dreißig ist.
Die ersten Wochen waren intensiv. Wir sahen uns fast jeden Tag. Spaziergänge, Vernissage, einmal im Konzerthaus. Liszt. Liebestraum. Abende bei Kerzenschein, Händchenhalten, Gespräche, die nie langweilig wurden. Wir machten Pläne. Keine Luftschlösser, sondern greifbare Dinge: ein Häuschen vielleicht, irgendwann Kinder, bevor die biologische Uhr abläuft. Ich ließ mich darauf ein. Ohne Zweifel. Ohne doppelten Boden.
Dann der gemeinsame Urlaub auf Teneriffa. Sonne, Salz auf der Haut, Nähe. Es war schön. Wirklich. Abends saßen wir oft in kleinen Strandlokalen, der Rotwein offen auf dem Tisch, die Wellen leise im Hintergrund. Und doch: Mit jedem Gespräch kam auch Reibung. Ihre Ansichten, ihr Blick auf die Welt, ihre Pläne, vieles passte nicht zu meinen. Es waren keine Kleinigkeiten. Es ging um Grundsätzliches. Um die korrekte Haltung. Um das, was einem wichtig ist im Leben. Und um das, was sich nicht gehört, sagte sie.
Aber wir wollten es. Wir glaubten daran. Wir sagten: Das schaffen wir schon. Gegensätze ziehen sich an, sagten wir und lachten.
Ich glaubte das wirklich.
Nach dem Urlaub wurde es stiller. Die stündlichen Whatsapp hörten auf. Statt „Komm vorbei“ hieß es: „Ich muss noch was erledigen.“ Zwei Treffen pro Woche. Früher war es tägliche Nähe gewesen. Jetzt: freundliches Zögern, als ob wir uns nie geküsst hätten.
Dann der Anruf.
„Ich bin schwanger“, sagte sie.
Kein Zittern in der Stimme. Kein Lächeln.
Und dann sofort hinterher: „Man kann ja was dagegen tun.“
Ich konnte nichts sagen. Ich saß da, das Handy in der Hand, das Herz irgendwo zwischen Kehle und Brustbein. Ich hörte meine Gedanken nicht mehr. Nur noch das eine Wort: Vater. Ich würde Vater.
Vor meinem inneren Auge begann ein Film zu laufen. Ich sah eine kleine Wiege, aus Holz, selbst gebaut. Unperfekt, aber mit Herz. Ich sah ein Kinderzimmer mit leuchtenden Sternen, die ich an die Tapete kleben würde. Ein Musikspiel würde ich über dem Bettchen anbringen, Plüschtiere mit Pumuckel, mit zu großem Kopf besorgen. Neben der Wiege sah ich mich stehen, mit jedem Atemzug das Kinderlächeln einatmen. Ich sah mich nachts am Bett, leise summend, Rotkäppchen vorlesen, wie es meine Mutter für mich tat, als ich nicht einschlafen wollte. Schon im Urlaub hatte ich mir vorgestellt, wie wir zu Dritt barfuß am Strand entlang gehen würden, lachend, fröhlich. Familie, wie gut sich das doch anfühlen würde.
Ich hatte dem Kind sofort einen Namen gegeben. Maxi.
Weil Maxi für Mädchen wie für Jungen passt.
Und weil es – in diesem Moment – auch mein Kind war.
Mein Kind, das ich nicht beschützen durfte.
Der Bauch gehörte ja nicht mir.
Doch sie sah das alles nicht. Sie sprach von „dem Eingriff“. Von „es wäre jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt“.
Ich sagte, das ist auch mein Kind, das ich lieben werde. Sie ließ sich nicht abbringen, es schmerzte so sehr, ich konnte nicht essen, nicht schlafen. Völlig fertig mit verweinten Augen.
Zwei Tage später war ihr Termin.
Ich bekam meine Wohnungsschlüssel per Einschreiben zurück. Ohne Nachricht. Ohne Gespräch. Einfach – zu Ende.
Ich war am Boden. Nicht nur die Beziehung war vorbei. Ich hatte auch mein Kind verloren.
Ein Kind, das nie zur Welt kam.
Ein Kind, das man entfernte wie einen entzündeten Blinddarm.
Für sie war es eine Entscheidung. Für mich war es ein Schnitt durch die Seele.
Ich durfte mein Kind nie sehen. Nie halten. Ihm nie ein Lied vorsingen, es nie wickeln, nie „Papa“ sagen hören.
Keine Gute-Nacht-Geschichten, kein Spielplatz, kein Geburtstag mit Kerzen.
Kein „Schau mal, Papa!“ Keine Fragen, die Kinder stellen, wenn sie die Welt noch für offen halten.
Und meine Eltern? Sie wussten nichts davon. Ich hätte es ihnen gern erzählt.
Wie stolz mein Vater gewesen wäre.
Das erste Enkelkind.
Manchmal sitze ich in der Bahn und sehe einen Vater mit seinem kleinen Sohn. Oder ich höre auf der Straße ein Kinderlachen. Es trifft mich. Sofort.
Man sieht es mir nicht an. Aber innen bricht etwas. Jedes Mal.
Ich habe es niemandem erzählt. Nur mir selbst. Und in diesem Brief. Annonym.
Und Maxi. Meinem Kind, das nie leben durfte.
Aber in mir weiterlebt.
Maxi war da – bevor es da sein durfte.
Und ich war Vater – bevor man mir das Vatersein genommen hat.
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.