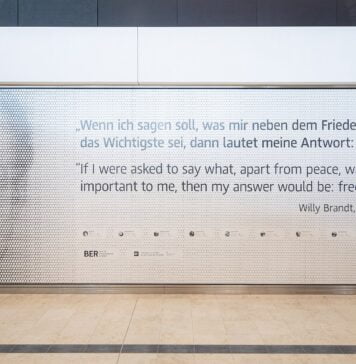Ein Gastbeitrag von Herwig Schafberg
„Der Nationalstaat darf gewiß nicht als höchster Wert gelten, aber er ist in ganz Europa immer noch eine seelische Notwendigkeit. Wo Nationen in ungeliebte Staaten gepfercht werden, dort besteht Gefahr für ihre Freiheit und für den Frieden.“ (Helmut Schmidt am 3. Oktober 1991, dem ersten Jahrestag der deutschen Einheit)
Handeln für Deutschland war das, was Helmut Schmidt als Politiker zielstrebig im Sinn hatte – und es ist der Titel eines seiner vielen Bücher, in denen es um politische Entwicklungen und Probleme geht, die ihm sowie anderen Politikern zu schaffen machten. Da er mit seinen Büchern selber Geschichte schrieb und in dem Zusammenhang auch Bilanz des eigenen Handelns zog, ist es nicht ganz richtig, wenn er auf die Frage, wie er seine Rolle in den Geschichtsbüchern sähe, zur Antwort gab, das wäre ihm nicht wichtig; „denn wenn es geschrieben wird, bin ich längst tot.“
Am 23. Dezember ist Helmut Schmidts 100. Geburtstag, den er nicht mehr miterleben kann. Er starb 2015 nach einem langen schaffensreichen Leben als hoch angesehener Politiker und Publizist.
Wer im Staat mitgestalten wollte, sagte einst der damalige Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier, der müßte „in die Aschenbahn der Politik herabsteigen, oder aber die Politik mit seiner Feder so beeinflussen, daß er dabei gehört wird.“ Helmut Schmidt tat beides: Er war als Abgeordneter im Bundestag, als Hamburger Senator, als Bundesminister sowie Bundeskanzler dreißig Jahre lang in zunehmendem Maße an der Gestaltung der Politik in der Bundesrepublik Deutschland beteiligt (1953-1982) und gab dann im letzten Drittel seines Lebens als „Elder Statesman“ mit Schreiben und Reden Ratschläge, auf die allerdings nicht immer und überall gehört wurde.
Im Unterschied zu vielen seiner jüngeren Parteigenossen war ihm die nationale Frage stets wichtig gewesen: „Zwar haben manche Intellektuelle uns schon des Längeren einreden wollen, wir sollten freiwillig auf unsere nationale Identität verzichten, sie sei nicht mehr zeitgemäß“, schrieb er ein Jahr nach der wiedergewonnen Einheit Deutschlands in seinen von der ZEIT veröffentlichten „Einmischungen“: „Aber diese klugen linken Liberalen haben bloß für ihresgleichen gesprochen, die – angesichts unserer Geschichte nicht unverständlich – Schwierigkeiten damit hatten, sich mit ihrem eigenen Volk zu identifizieren. Tatsächlich hingen wir Deutschen – sei es in Leipzig oder Weimar,… in Hamburg oder Heidelberg – an der gemeinsamen Nation, aus den gleichen Gründen wie die Polen oder die Ungarn… die Franzosen, die Holländer oder die Engländer.“
Die SPD, die als einzige unserer bisher staatstragenden Parteien die Bezeichnung Deutschland im Namen führt, könnte wie ihr langjähriger Kanzler „Handeln für Deutschland“ als leitende Maxime ausgeben, wenn sie noch wie in den fünfziger Jahren für sich in Anspruch nähme, DIE Deutschland-Partei zu sein. Es war damals die Zeit der Auseinandersetzungen zwischen der CDU Konrad Adenauers, für den die Westbindung der Bundesrepublik Vorrang hatte, und der SPD Kurt Schumachers, dem es vor allem um die Wiedervereinigung Deutschlands ging.
Es war die Zeit, in der Helmut Schmidt als sozialdemokratischer Abgeordneter in den Bundestag einzog und mit scharfem Verstand sowie rhetorischem Talent in die Debatten des Parlaments eingriff.
Im Zusammenhang mit der Westbindung ging es unter anderem um die Aufstellung der Bundeswehr, mit der die SPD sich zunächst nicht anfreunden mochte. Und das bekam auch Helmut Schmidt zu spüren, der 1958 seinen Posten im Vorstand der Bundestagsfraktion verlor, weil er – ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier – an einer Übung der Bundeswehr teilgenommen hatte.
Aus seiner Zeit in der Wehrmacht hatte er übrigens den Spitznamen „Schmidt-Schnauze“, wie ich von einem Onkel weiß, der als Soldat unter ihm zu dienen hatte. Da Helmut Schmidt als Schüler zwar zu den Kleinsten in seiner Schulklasse gehört, aber bereits damals eine „große Klappe“ gehabt und freimütig seine Meinung gesagt hatte, war er auf der Schule als „Revolver-Schnauze“ bekannt geworden.
Mit der Meinungsfreiheit war es vorbei, nachdem die Nationalsozialisten 1933 an die Macht gekommen waren. Helmut Schmidt schwieg genauso wie andere, als eine der beliebtesten Lehrerinnen seiner Schule verhaftet wurde. Er wollte wie andere Jungen seines Alters der Hitlerjugend beitreten; aber seine Eltern redeten ihm das aus und verrieten ihm ein wohlgehütetes Familiengeheimnis: Daß sein Vater nicht der leibliche Sohn des Großvaters, sondern unehelicher Sprößling eines deutschen Juden wäre. Wenn die staatlich verordnete Ahnenforschung das entdeckt hätte, wäre Helmut Schmidt als „Vierteljude“ manche berufliche Karriere verschlossen geblieben – auch die Laufbahn eines Wehrmachtsoffiziers, die er einschlug, als er nach dem Beginn des 2. Weltkrieges seine Studienpläne vorläufig aufgeben mußte.
Helmut Schmidt ging als Soldat im realen Sinne des Wortes „durch` s Feuer“ und wurde durch die „Scheiße des Krieges“, wie er es nannte, ebenso tief geprägt wie andere, die nach dem Krieg in die Politik gingen und ihre ganze Kraft daran setzten, um Deutschland wieder in Ordnung zu bringen.
„Wer in die Politik gehen will, soll einen Beruf gelernt und ausgeübt haben,“ schrieb Schmidt in seinem Buch „Außer Dienst“ und dachte dabei vermutlich an die vielen jüngeren Politiker, die im Laufe der letzten Jahrzehnte ohne berufliche Erfahrung politische Verantwortung übernommen haben. „Er soll die Geschichte Deutschlands und die unserer wichtigsten Nachbarn kennen; und er soll sich auf mindestens einem Fachgebiet als Experte einarbeiten,“ mahnte er weiter und wünschte sich auch „ökonomisches Verständnis als Mindestvoraussetzung“, das er „den meisten Politikern“ absprach. So gesehen wäre ein Mann wie Friedrich Merz vermutlich eher nach seinem Geschmack gewesen als Leute wie die abgebrochene Theologiestudentin Kathrin Göring-Eckart.
Er selber war 1946 in die SPD eingetreten, hatte Volkswirtschaft studiert und nach dem Examen 1949 einen Posten in der Hamburger Behörde für Wirtschaft und Verkehr erhalten. Derselbe Karl Schiller, dem Helmut Schmidt 1972 als Bundeswirtschafts- und Finanzminister nachfolgte, war seinerzeit als Senator der Freien und Hansestadt Hamburg Chef dieser Behörde und verweigerte Schmidt den weiteren Aufstieg in die Führungsebene der Hamburger Hafen- und Lagerhaus-Gesellschaft.
„Da bin ich aus Daffke in den Bundestag gegangen,“ erzählte Schmidt später, mußte sich dort allerdings finanziell bescheiden; denn Bundestagsabgeordnete waren damals noch nicht so üppig versorgt wie heute. Wie Helmut Schmidt erzählte, reiste er am Wochenende nicht mit der Bahn oder mit dem Flugzeug von Bonn heim nach Hamburg, sondern mit seinem VW-Käfer, weil er zur Tilgung des Darlehens, das er zur Finanzierung seines Wagens aufgenommen hatte, auf das Kilometergeld angewiesen war. Und seine Frau Loki führte in der Zeit ein Haushaltsbuch, um genau zu kontrollieren, was die Familie sich an Ausgaben leisten konnte. Insofern ging es der Familie finanziell besser, nachdem Helmut Schmidt 1961 zum Polizei- beziehungsweise Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg berufen worden war.
In dem Amt wurde Helmut Schmidt während der verheerenden Sturmflut im Februar 1962 weit über die Grenzen der Stadt hinaus als Krisenmanager berühmt.
Damals waren Deiche an der Elbe gebrochen und einige Wohngebiete so hoch überschwemmt worden, daß Menschen sich zu Tausenden auf die Dächer ihrer Häuser retten mussten, wenn sie nicht wie viele Hundert andere ertrinken wollten. In der Notlage bewährte sich Schmidt als verantwortlicher Senator bei der Koordination von Rettungseinsätzen und scheute sich auch nicht, Hilfeleistungen der Bundeswehr sowie anderer NATO-Truppen in Anspruch zu nehmen. Dafür gab es zwar keine gesetzliche Grundlage; aber darüber setzte er sich ebenso hinweg wie später über Rauchverbote. Er wollte getan wissen, was zur Rettung sowie Versorgung der Notleidenden machbar war, interessierte sich in der Situation kaum für rechtlich relevante Einwände und ließ Behördenmitarbeiter, die Bedenken hatten, nicht zu Worte kommen. Im Alter auf sein übergesetzliches Handeln angesprochen, gab er lapidar zu verstehen: „Ich habe das Grundgesetz nicht angeguckt in jenen Tagen.“
Doch als zu Schmidts Amtszeit als Bundesverteidigungsminister Bundeswehroffiziere ihre Loyalität gegenüber dem Grundgesetz bekundeten, war das dem alten Soldaten „zu harmlos“; denn „gegenüber dem Grundgesetz gibt es nichts als Gehorsam“, forderte er nach meinen Erinnerungen vor laufender Kamera und fügte hinzu: „jedenfalls für Soldaten!“
Mit seinem Krisenmanagement während der Flutkatastrophe in Hamburg hatte Helmut Schmidt ein Vorbild für Bundeswehreinsätze bei den Flutkatastrophen an Elbe und Oder zu Ende des letzten sowie zu Beginn dieses Jahrhunderts geschaffen.
Inzwischen waren derartige Einsätze legalisiert durch Notstandsgesetze, die 1968 von der Großen Koalition im Bundestag durchgesetzt worden waren. Seinerzeit war Schmidt, der 1965 in den Bundestag zurückgekehrt war, Vorsitzender der SPD-Fraktion und hatte Bedenken in seiner Fraktion gegen diese Gesetze zu entkräften.
Bedenken, daß mit der Notstandsgesetzgebung etwas ähnlich Verhängnisvolles wie das „Ermächtigungsgesetz“ von1933 in Kraft gesetzt würde, gab es nicht bloß in der SPD, sondern in allen links orientierten Kreisen. Und es kam zu heftigen Protesten der „Achtundsechziger“, bei denen die Studentenbewegung eine große Rolle spielte.
Während der SPD-Vorsitzende Willy Brandt seine Partei für die jungen „Achtundsechziger“ öffnen wollte, blieb Helmut Schmidt auf Distanz zu dieser Bewegung.
Er trat dafür ein, Probleme tatkräftig anzupacken, statt lange herumzureden. „Willy führt ja nicht,“ klagte Schmidt, der sich von dem 1969 zum Bundeskanzler avancierten Brandt mehr Führungsstärke zur Bekämpfung extremer Kräfte in der Studentenbewegung wünschte. „Wir reden und reden – und währenddessen hauen die in Kiel dem Rektor in die Fresse und scheißen dem Richter vor den Tisch“, empörte er sich in vertrauter Runde, nachdem Studenten den Rektor der Kieler Universität tätlich angegriffen hatten und ein Student seinen Protest dadurch zum Ausdruck gebracht hatte, daß er während eines Prozesses im Gerichtssaal seine Notdurft verrichtete.
Daß „der Staat mit aller Härte“ auf Bedrohungen reagieren müßte, fand Schmidt schon als Verteidigungsminister (1969-1972) und auch nach einer Zwischenetappe im Amt des Wirtschafts- und Finanzministers (1972-1974) als Brandts Nachfolger an der Spitze der Bundesregierung (1974-1982). Hatte er sich als neuer Bundeskanzler nach der Entführung des Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz durch die „Bewegung 2. Juni“ (1975) noch auf die geforderte Freilassung inhaftierter Gesinnungsgenossen der Entführer eingelassen, um den Entführten zu retten, entschied er danach, daß der Staat keiner weiteren Erpressung nachgeben dürfte. Helmut Schmidt und seine Frau Loki erklärten insofern schriftlich, daß sie im Falle einer Entführung auf keinen Fall ausgetauscht werden wollten, und ließen ihre Tochter vorsorglich in sicherer Entfernung an einer britischen Universität studieren.
Helmut Schmidt ließ sich nicht erweichen, als die „Rote Armee Fraktion“ (RAF) 1977 den Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer entführte, um die Freilassung ihrer inhaftierten Führungsgenossen zu erpressen. Anders als Willy Brandt in einer ähnlichen Situation (1972) blieb er auch hart, als ein palästinensisches Terrorkommando ein Flugzeug mit deutschen Urlaubern entführte, um den RAF-Forderungen Nachdruck zu verleihen. „Wir hatten alle die Kriegsscheiße hinter uns… und waren abgehärtet“, erzählte er im hohen Alter dem ZEIT-Chefredakteur di Lorenzo: „Der Krieg war eine große Scheiße, aber in der Gefahr nicht den Verstand zu verlieren, das hat man damals gelernt.“ Er übernahm die politische Verantwortung für den Einsatz einer GSG 9-Einheit zur Befreiung der entführten Geiseln im somalischen Mogadischu und verfaßte ein Rücktrittsgesuch für den Fall, daß die Aktion mißlingen würde. Doch sie glückte und Schmidt stand auf dem Höhepunkt seiner Popularität als Krisenmanager.
Er führte – wie es schien – die Bundesrepublik Deutschland in den siebziger Jahren auch mit Augenmaß durch die weltweite Wirtschaftskrise, die durch ein arabisches Ölembargo ausgelöst worden war (1973).
Die Krise war ausgebrochen, nachdem die arabischen Mitglieder der OPEC (Organisation Erdöl exportierender Staaten) im Herbst 1973 die Erdölproduktion reduziert und durch die erfolgte Verknappung der Ölmenge auf dem Weltmarkt für einen deutlichen Anstieg der Ölpreise gesorgt hatten. Als die höheren Aufwendungen für das wirtschaftlich unverzichtbare Öl und der dadurch bedingte Kaufkraftentzug zur Erhöhung der Arbeitslosigkeit und zur Verwerfung der Zahlungsbilanzen führte, war Helmut Schmidt noch Bundesfinanzminister und bemühte sich gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Valery Giscard d` Estaing lange vergeblich, die westlichen Bündnispartner für eine geschlossene Haltung gegenüber der OPEC zu gewinnen.
Nachdem Schmidt Bundeskanzler geworden war (1974), setzte er seine Bemühungen um gemeinschaftlich abgestimmtes Handeln fort und gab führenden Politikern anderer Länder Ratschläge, die in einigen Ländern mehr, in anderen weniger gut ankamen. Besonders gerne beriet sich „Le Feldwebel“, wie eine französische Gazette ihn nannte, mit seinem inzwischen zum französischen Staatspräsidenten avancierten Freund Giscard d` Estaing und rief zusammen mit diesem die G7 ins Leben – ein Gremium, in dem die Staats- und Regierungschefs der sieben wirtschaftlich stärksten Länder des Westens sich regelmäßig zur Beratung von weltpolitischen Fragen sowie zur Abstimmung ihres Handelns trafen. Und auf Initiative der beiden wurde 1979 auch das Europäische Währungssystem geschaffen, aus dem später die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion hervorging.
„Persönlicher Respekt und persönliche Freundschaft gegenüber führenden Politikern, gleich welcher Nation und gleich welcher Richtung, sind für mich immer eine Quelle der Bereicherung gewesen“, schrieb er in den oben genannten „Einmischungen“: „Zwar ist es wichtig, mit Richelieu zu wissen: ´Staaten haben Interessen.` Aber Staaten werden von Menschen gelenkt, und es ist für den Umgang mit den Regierenden anderer Staaten ein unschätzbarer Vorteil, wenn man Vertrauen haben kann in die Aufrichtigkeit und in die Stetigkeit der Leute, welche die Interessen ihres Landes zu interpretieren haben.“
Der viel gepriesene „Weltökonom“ Schmidt stand für das Erfolg versprechende „Modell Deutschland“, das allerdings Risse hatte und überholungsbedürftig war, wie sich immer klarer zeigte.
Daß viele Wirtschaftsunternehmen ihre Betriebsabläufe rationalisierten und Arbeitsplätze einsparten, war nicht bloß eine Folge des Preisanstiegs für Öl, sondern auch der Finanzpolitik, mit der die sozialliberale Koalition (SPD/FDP) seit ihrem Antritt 1969 die vielen versprochenen Reformen finanzieren und einige Sozialdemokraten die „Belastungsgrenzen der Wirtschaft“ testen wollten.
Helmut Schmidt dagegen wollte sich als Bundesfinanzminister und dann als Bundeskanzler unter dem Eindruck der Rezession zwar auf keine unnötigen Ausgabenwünsche einlassen, aber mit Konjunkturprogrammen die Wirtschaft zu mehr Investitionen sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen ermutigen und nahm eine steigende Verschuldung des Staates in Kauf, weil er hoffte, daß die Konjunkturzyklen bald wieder mehr Beschäftigung sowie höhere Steuereinnahmen mit sich bringen würden und die Schuldenlast dann reduziert werden könnte.
Doch die Arbeitslosigkeit nahm ebenso weiter zu wie die öffentliche Verschuldung, so daß sein Koalitionspartner, die FDP, eine „Wende“ in der Politik zur Eindämmung der Ausgaben insbesondere für Sozialleistungen und zur Konsolidierung des Haushalts forderte. Da die die SPD sich dagegen sperrte, kam es 1982 zum Koalitionsbruch und zur Wahl Helmut Kohls als Bundeskanzler, so daß Helmut Schmidt, der Mann mit der berühmt gewordenen Lotsenmütze auf dem Kopf, von Bord des Staatsschiffes gehen mußte.
Es lag nicht allein an der FDP, daß die Ära Schmidt zu ende ging, sondern auch daran, daß Helmut Schmidt in den Reihen seiner Parteigenossen Rückhalt verloren hatte.
„Solange wie ich im Amt war, haben die sich einigermaßen ordentlich benommen. Hinterher kamen plötzlich alle möglichen Weltverbesserer“, beklagte er sich nach seinem Ausscheiden: „Und darunter leidet die SPD zum Teil heute noch, an diesem Hang zur Weltverbesserung.“
Willy Brandt als Partei- sowie Herbert Wehner als Fraktionsvorsitzender hatten lange dafür gesorgt, daß die SPD nicht von dem Kurs abwich, den Schmidt als Regierungschef steuerte. Die drei Männer hatten die sogenannte „Troika“ gebildet, die tatsächlich wohl eher ein Triumvirat von Männern war, die gemeinsame Ziele hatten, diese aber nicht alle auf dem gleichen Wege erreichen wollten.
In der Friedens- und Entspannungspolitik, die Willy Brandt eingeleitet hatte, waren sie sich prinzipiell einig; die Wege von Brandt und Schmidt trennten sich aber, als es um den NATO-Doppelbeschluss ging:
Falls die Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion scheiterten und die Sowjets weiter massiv Mittelstreckenraketen in Osteuropa stationierten, sah dieser Beschluss die Stationierung neuer NATO-Raketen mit Atomsprengköpfen in Westeuropa vor, um damit die Gegenseite zum Einlenken zu zwingen und so eine beiderseitige Abrüstung zu erreichen. „Damit stehe ich und falle auch damit,“ verkündete Helmut Schmidt, auf dessen Initiative dieser Beschluß zurückging.
Solange er Kanzler war, schien nicht nur die SPD-Fraktion, sondern auch die Mehrheit seiner Partei hinter ihm zu stehen. Eine Minderheit bildete sich jedoch schon damals ein, „das Gleichgewicht werde von den Amerikanern und nicht von den Russen durch die SS-20 gestört“, berichtete der Bundeskanzler dem neuen französischen Staatspräsidenten Francois Mitterand 1981, wie in seinen „Einmischungen“ zu lesen ist. Und eine andere Minderheit meinte, „die Russen wären zu einer Verschrottung der SS-20 durch Verhandlungen bereit, auch ohne daß zunächst der Wille des Westens bekundet werde, diesen Raketen ein Gegengewicht entgegenzusetzen.“ Er hielt mit Zustimmung Mitterands „die erstere Minderheit für töricht und die letztere für illusionär.“
Doch nach dem Sturz Helmut Schmidts als Regierungschef sprachen Willy Brandt, Erhard Eppler sowie Oskar Lafontaine sich gegen den NATO-Doppelbeschluß aus und brachten sowohl auf einem Parteitag 1983 als auch im Bundestag die Mehrheit der Sozialdemokraten dazu, gegen den Beschluss zu stimmen, der allerdings durch die Zustimmung der neuen Koalition aus CDU/CSU und FDP eine Mehrheit im Parlament fand.
Daß der Doppelbeschluss wie beabsichtigt zum Abschluß eines Abrüstungsvertrages zwischen den USA und der UdSSR führte (1987), war ein Weg, den Helmut Schmidt nicht mehr als Gestalter, sondern nur noch als Erklärer des Weltgeschehens – nicht ohne Zigarette in der Hand – begleiten konnte.
“Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, hatte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Schmidt sich über die Zielvorstellungen gelästert, mit denen seine Partei 1980 Wahlkampfwerbung machen wollte. Doch auch und besonders mit seinem Wirken in der Sicherheits- sowie in der Europapolitik hatte er deutlich gezeigt, dass er selber durchaus – mit Augenmaß – Visionen hatte. Und das zeigte er deutlicher mahnend denn je in seinen Reden, Büchern und Artikeln für die ZEIT, deren Mitherausgeber er 1983 geworden war.
In der Rolle des Mahners, der hoch über den Niederungen der Tagespolitik zu stehen schien, wuchs sein Ansehen weit über die Parteigrenzen hinaus. Und eine große Mehrheit des deutschen Volkes wünschte sich den Altbundeskanzler Helmut Schmidt sowie den Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker an der Spitze des Staates, als die beiden Männer schon über 90 Jahre alt waren. Diese Wunschvorstellung sprach nicht gerade für eine hohe Reputation der nachgewachsenen politischen Akteure im Land.
Inwieweit der Mahner in den letzten Jahren noch Gehör in seiner Partei fand, ist schwer zu sagen. Die Genossen schmückten sich gerne mit dem Denkmal, zu dem er schon zu Lebzeiten erhoben war, schwiegen aber, wenn er manches von sich gab, was nicht der Parteilinie entsprach. Wie ich von Mitarbeitern der SPD-Bundestagsfraktion weiß, feixte mancher sozialdemokratische Abgeordnete hinter vorgehaltener Hand, wenn der alte Herr zu Besuch kam und seinen Genossen die Leviten las.
Selbst wenn er noch jünger gewesen wäre und es gewollt hätte, wäre wohl kaum noch eine Parteigliederung bereit gewesen, Helmut Schmidt ein Amt oder Mandat zu geben.
Wenn es um Probleme der Migration und Integration von Ausländern ging, stand er Parteifreunden wie Thilo Sarrazin näher als anderen. Er hielt es für einen Fehler, daß man in den sechziger Jahren so viele „Gastarbeiter“ aus fremden Kulturkreisen ins Land geholt hatte. Dementsprechend hatte er sich als Regierungschef dagegen verwahrt, dass sein türkischer Amtskollege Demirel 15 Millionen weitere Türken hierzulande aufnehmen lassen wollte, und im kleinen Kreis geschnauzt: „Es kommt mir kein Türke mehr über die Grenze.“ Doch er hatte nicht den Nachzug von Familienangehörigen verhindert, so daß der türkische Bevölkerungsanteil weiter zunahm.
Das Projekt einer multikulturellen Gesellschaft sei eine Illusion, warnte er wiederholt. „Wir werden angesichts der Bevölkerungsexplosion in den uns benachbarten Teilen der Welt allerdings ein gewisses Maß an Einwanderung ertragen müssen“, meinte er im „Handeln für Deutschland“, und „angesichts unseres eigenen Schrumpfungs- und Vergreisungsprozesses… ein gewisses Maß an Einwanderung in nicht allzu kurzer Zeit sogar nötig haben“, doch wer die Zahl der Muslime in Deutschland erhöhen wolle, nähme „eine zunehmende Gefährdung unseres inneren Friedens in Kauf“, schrieb er einige Jahre später besorgt in seinem Buch „Außer Dienst“.
Als Peer Steinbrück in einer TV-Sondersendung zum Tode Helmut Schmidts gefragt wurde, was der denn zur Bewältigung der Flüchtlingskrise 2015 getan hätte, vermutete Steinbrück, daß Schmidt gewiß nicht gesagt hätte: „Wir schaffen das,“ ohne einen Plan zu haben. Ob zu solch einem Plan ähnlich wie bei der Sturmflutkatastrophe 1962 ein Bundeswehreinsatz zur Eindämmung der Flüchtlingsströme gehören würde, auch wenn das nicht im Gesetz als Aufgabe der Streitkräfte vorgesehen ist, können wir ihn bedauerlicherweise nicht mehr fragen; wir können aber darüber nachdenken, was ihm im „Handeln für Deutschland“ besonders wichtig war:
„Arbeite lieber für die Beseitigung von konkreten Mißständen als für die Verwirklichung abstrakter Ideale.“ Mit diesen Worten zitierte Helmut Schmidt seinen Lieblingsphilosophen Karl Popper und fügte hinzu: „Bei uns ist bisweilen die umgekehrte Praxis zu beobachten.“