
V
Auch wenn man mich im Schlaf hierher versetzt und es mir nicht gesagt hätte – dass dies die Mongolei war, sah ich auf den ersten Blick. Das hier war eindeutig jenseits der Zivilisation. Häuser bestanden aus zum Teil eingefallenen Mauern, über die man als Abdeckung Bretter gelegt und darauf wiederum Bauschutt geworfen hatte – losen, sandigen Putz, Ziegelreste usw. Zwischen diesen „Häusern“ standen hier und da weiße Jurten oder Blechunterkünfte, die wie alte, bis zur Hüfte eingegrabene Eisenbahnwaggons anmuteten. Windschiefe Gartenzäune aus Holz oder rostigem Metall unterteilten die Grundstücke. Mit blauer Farbe und Pinsel waren Worte wie „Shop“, „Cafe“ und „HOTEL“ an bröckelige Wände und die Blechbuden gemalt. Nie im Leben wäre ich ein solches „Hotel“ gegangen. Lieber hätte ich mich zu einer Viehherde unter freiem Himmel gesellt. Erstaunlicherweise gab aber auch in dieser Tristesse richtige Häuser. Sogar ein großes, mit einem hohen Sichtschutz umzäuntes Blockhaus, das einen sehr ordentlichen Eindruck machte. Vermutlich eine Unterkunft für russische oder westliche Abenteuer-Reisegruppen. Doch der Gesamteindruck von Ulaanbaischint – so hieß der Ort – war nahezu desaströs. Hier sah es aus wie nach einem Bombenangriff: die Trümmer weggeräumt, während in den Ruinen Menschen hausten. Ähnliches war mir bisher nur im Busch von Tansania begegnet. Ich sah zu, dass ich fortkam.
Dafür entschädigten die folgenden Kilometer. Die planierte Piste war breit, ohne schlimme Schlaglöcher und führte lange bergab. Zu beiden Seiten ging die baumlose Steppe in Hügel und Berge über, die mich wie stumme Wächter zu beobachten schienen. Die höchsten Berge waren geradeaus vor mir. Auf diese führte die Piste zu, wandte sich dann aber nach links. Einen winzigen Moment spielte ich mit dem Gedanken, einfach immer weiter zu fahren, so lange das Auto mitmachte, Richtung Gobi. Aber dann dachte ich an Sascha. Ich hatte es versprochen. Es wäre auch Irrsinn. Vor mir tauchten zwei Radfahrer auf. Fabian und Bilkin, gemeinsam unterwegs nach Ulaan-Bator. Beim Überholen winkten wir uns noch ein letztes Mal zu.

Wie ich nun so bergab rollte, mit angenehmen 50 Stundenkilometern, ganz mit mir selbst allein und vor mir nichts, als die mongolische Steppe, an grasenden Viehherden vorbei und einem Nomanden-Jungen zu Pferde, der Ziegen trieb, an weiteren allein fahrenden Radreisenden vorbei, wie ich so meine eigene Staubwolke im Rückspiegel betrachtete, die Berge und ein paar einsame Jurten-Siedlungen und nichts hörte, als das ratternde, knirschende Geräusch der ewig rollenden Räder auf dem harten, trockenen Grund, da kamen mir auf einmal die Tränen. Ich war weder glücklich, noch traurig. Aber ich hatte Zeit. Da stellte sie sich mir wieder entgegen, die Frage, ganz leise, doch unüberhörbar: Warum bist du so weit gefahren?
Ja, warum . . . ?
Ich wusste es. Und ich wollte es aussprechen. „Muss ich denn“, ereiferte ich mich unter Tränen, „muss ich denn erst so weit gehen? Muss ich erst hierher kommen?“ Keine Antwort. Die war auch nicht nötig. „Anscheinend.“ Die Tränen liefen und liefen. Ich wehrte mich nicht. „So weit muss ich also erst fahren. Es warst immer nur du …“
Ich war nicht allein. Er war da und schenkte mir ein paar Minuten des Begreifens. Ich wischte mir übers Gesicht. Still ließ ich den Bus rollen, gab manchmal ein bisschen Gas und fühlte mich unendlich wirklich. Alles war friedlich, alles war zurechtgerückt und eingebettet wie schon lange nicht mehr. Keine Frage, die bewegt werden musste. Denn die Antwort durchdrang alles und war viel zu groß. Links ein kleiner See. Hinter ihm wuchs ein dramatisch geformter Felsen aus der Steppe – ein markanter Punkt, denn an seinem Fuße beschrieb die Piste eine S-Kurve, bevor sie über viele Kilometer erneut kerzengerade über die Ebene verlief, an deren äußerstem Ende eine kleine weiße Stadt lag. Doch bis dorthin würde ich nicht mehr kommen. Ich wusste es. Gegenüber des Sees, auf der anderen Seite der Fahrbahn, erblickte ich die Ruine einer Siedlung im Feld. Reste von Steinmauern, kaum hüfthoch. Ein Weg zweigte von der Piste ab und führte nach rechts in die Berge. Da wollte ich hin. Nach ein paar hundert Metern sah ich einen Menschen auf einem Motorrad, der um eine Viehherde herum fuhr. Ich stoppte. Nun erging es mir wie Sascha: ich hatte kein Bedürfnis nach Menschen. Weder wollte ich jemanden mit meiner Anwesenheit belästigen, noch selbst Fragen gestellt bekommen. Ich brauchte jetzt die Einsamkeit. Ich fuhr wieder zurück und schaute mir – als könne sie Schutz bieten – die Ruine der Siedlung von Nahem an. Ein Innenhof und zum Teil unterirdisch gelegene Räume. Doch es kamen immer wieder Autos von der Grenze. Ich fand keine Ruhe. Deshalb nahm ich endlich in Angriff, was ich seit Taschanta hatte tun wollen: auf eine dieser Bergdünen, eine dieser erstarrten, urzeitlichen Riesenwellen steigen und mir das Riesenmeer von oben ansehen. Weil ich nicht so weit gehen wollte, fuhr ich mit dem Bus den Berghang hoch. Solange, bis der Felsbrocken, über die er sich quälen musste, zu viele wurden. Gut, dass ich keine Ahnung hatte, an welch seidenem Faden in diesem Moment alles hing. Jemand meinte es gut mit mir. Und ich bekam nichts davon mit.

Ich stellte den Bus ab – meine weiße Barkasse im grünen Ozean – und rüstete mich zur Besteigung. Im Rucksack nahm ich mit: Wasser, einen Spaten, ein Nageleisen, meine Schiebermütze aus Wolle und die Camera. Hoffentlich würde der Akku noch halten. Ich hatte ihn seit Aktasch nicht mehr geladen. Bereits gestern war die Energieanzeige auf den letzten Strich zurück gegangen. Der Aufstieg war hart. Viel härter als mein gestriger Lauf Sascha hinterher. Früher war ich oft in den Alpen gewesen. Auch auf dem Kilimanjaro hatte ich schon gestanden. Dort war mir bei Minusgraden das Trinkwasser eingefroren, so dass ich die letzten 1000 Höhenmeter fast ohne Flüssigkeitszufuhr bewältigen musste. Eine Grenzerfahrung. Das hier war nicht einmal halb so hoch. Bis 3000 Meter spürte ich normalerweise die Höhe kaum. Hier, auf 2300 Meter, schlauchte mich die Kraxelei und verlangte meine letzten Kräfte. Es konnte nicht nur an der Höhe liegen. Wie froh war ich, meine Wintermütze und die lange Feldjacke dabei zu haben. Ohne sie hätte die Sonne meinem Unterfangen zweifellos vorzeitig den Garaus gemacht. Und selbst mit diesen beiden Kleidungsstücken tat mir die Sonne mehr als genug weh. Meine Wasserflasche wurde viel zu schnell leer. Ich sparte und trank nur wenig, obwohl ich großen Durst verspürte. Immer wieder musste ich mich hinsetzen und verschnaufen. Laut pulsierte das Blut in meinem Schädel. Die Kuppe des Berges aber wollte und wollte nicht näher kommen. Wieso musste ich auch den Spaten und das große Nageleisen mit da hoch schleppen! Sinnloses Gewicht.
Wie winzig der Bus geworden war. Ein weißes Etwas in der endlosen Steppe. Weiter, nicht aufgeben, auch wenn die Beine zitterten. Meine Heimatstadt kam mir in den Sinn. Ein Bild von allen Verwandten in der Gaststätte, in welcher unsere Familie ihre Feste zu feiern pflegt. Ich sah sie um die lange Tafel sitzen, in der ländlich hergerichteten Fachwerkstube. Und mich von meiner Reise bis in die Mongolei erzählen. Von meinen Abenteuern mit Sima, Victor und Sascha, von Nowosibirsk und Aktasch. Wieso musst ich jetzt – hier, in der Mongolei – daran denken? An diese Gaststube? An meine Familie? War es das? Meine Herkunft? Das Unauslöschliche – egal wie weit man fort geht? Der Nagel, der für alle Zeiten eingeschlagen worden war? Es gab darauf nur eine Antwort. Und sie lautete nicht „nein“. Und auch nicht „vielleicht“.
Ich kam oben an wie einer, der sich aus Seenot halb kriechend an Land rettet. Die Strapazen hatten mich so geschwächt, dass ich fürchtete, nicht mehr aufmerksam genug für den Abstieg zu sein – hoffentlich würde ich mir in meinen ausgetretenen Halbschuhen nicht den Fuß brechen. Ich stieß einen kleinen Triumph-Schrei aus, der in Wirklichkeit nur die krächzende Selbstvergewisserung war, dass ich noch lebte, und blickte mich um. Das war es: Dimensionen von erschreckender Schönheit. Der Mongolische Altai erstreckte sich in alle Himmelsrichtungen. Graubraune Drei- und Viertausender am südlichen und östlichen Horizont, hinter einem blassgrünen Land, dessen unzählige Hügel wie vielfach gewölbte Folie, wie ein aufgewühltes Meer, immer höher wurden. Ein Land aus einer anderen Epoche. Hier hatte die Zeit Abrahams überdauert. Konserviert durch die Trocken- und Abgeschiedenheit. All die Herden, die Nomaden … ich war nicht nur räumlich, ich war auch zeitlich zurück gereist. An einen Ort, der die äußerste Grenze alles Bekannten, alles Vorstellbaren, zu bilden schien: zu den Anfängen der Menschheit. Oh ja. Und dann sah ich noch etwas. Etwas, das fehlte, obwohl es hätte da sein müssen. Ein zweites Mal zog Er den Schleier weg. Zwischen den gegenüberliegenden Bergen gab es keine Scharten. Jene im Felsgebirge scharfen, im Hügelland sanften Einkerbungen also, die entstehen, wenn Berghang auf Berghang trifft. In den Scharten fließt das Wasser zu Tal. Sie bilden deshalb meist den Anfang von Flüssen. Mochten die Kuppen auch noch so sanft sein – es hätte diese Scharten geben müssen. Nun, die Scharten gab es durchaus. Doch sie waren aufgefüllt mit Material, das einst nicht Teil der Berge gewesen, das jünger als die Berge und offensichtlich später, lange nach Entstehung des Landes, hinzugekommen war. Das Füllmaterial in den Scharten begann gleich unterhalb der Gipfel und zog sich – immer breiter werdend, wie glatt gespachtelt und sagenhafte Ausmaße erreichend – bis ganz hinunter in die Ebene. Mir war das schon von der Ruine aus aufgefallen. Von hier oben allerdings sah man es ungleich besser. Und es bestand kein Zweifel: irgendwann einmal mussten diese Berge von Wasser bedeckt gewesen sein. Als der Wasserspiegel sank, lagerten sich unvorstellbare Mengen von Schlamm und Angeschwemmtem in die Scharten ein, trockneten, verwitterten und bekamen eine grüne Decke – es wuchs sozusagen Steppengras über die Sache. Unmöglich konnten diese Auffüllungen durch natürlichen Abtrag in einem Jahrtausende währenden Prozess entstanden sein. Kein Regen – wie gewaltig auch immer – wäre jemals in der Lage gewesen, so viel aus den Bergen herauszuspülen. Rinnen, in denen das Wasser heute abfloss, hatten sich übrigens durchaus viele in die breiten Zungen gegraben. Sie waren im Vergleich zu den verwitterten Füllungen geradezu winzig. Nein, hier musste eine Naturgewalt unvorstellbaren Ausmaßes gewirkt haben. Ihr Element musste das Wasser gewesen und es musste plötzlich gekommen sein. Gletscher? Eiszeit? Möglicherweise. Doch auch dazu brauchte es: sehr, sehr viel Wasser. Ich jedoch dachte an etwas anderes. An die Sintflut. Ich sah es mit eigenen Augen und dachte, dass alles wahr sein musste… Die alten Überlieferungen… Und wenn diese zutrafen – war dann, was ich erblickte, eine Ahnung der Unendlichkeit? Mehr als das! Für mich war es ein Beweis.
Ich stand da oben und spürte den schweigsamen Rhythmus der Erde, ihr Abwarten, ihren großen Schlaf, das leisen Atmen, das kaum merklichen Heben und Senken ihres Brustkorbes durch die Gezeiten hindurch. Was würde der Mensch je dagegen setzen können? Auch Gold gab es keines. Spaten und Nageleisen brachten nichts zu Tage. Ich war ohnehin viel zu erschöpft. Ralph hatte gesagt, man brauche es quasi nur aufzulesen. Aber das spielte keine Rolle mehr. Ein Reiter auf einem Pferd ritt langsam vom nächst höheren Berg über die Kuppe herab zu mir. Nun, da ich alles gesehen hatte, wünschte ich mir wieder, jemandem zu begegnen. Ich stellte mich so hin, dass er mich sehen musste. Dass er in mir einen Fremden erkennen musste. Doch kurz bevor er mich erreichte, drehte er ab und ritt den Berg hinunter. Als würde ich überhaupt nicht existieren. Das traf mich unerwartet stark. Es schmerzte. Wir waren die einzigen beiden sichtbaren Lebewesen weit und breit … und er ritt einfach vorbei. Ich sehnte mich plötzlich mit ganzer Wucht nach einem Menschen. (Sascha, wirst Du da sein?) Das am Nagel befestigte, unsichtbare Gummiband zerrte. Nie spürte ich es deutlicher, als in diesem Moment. Es war vollbracht – ich hatte den Umkehrpunkt meiner Reise erreicht. Keinen Schritt weiter. Ich stellte die Kamera auf einen Felsen, drückte auf Selbstauslösung und fotografierte mich.

Von hier aus gab es nur noch eine Richtung:
nach Hause.
VI
Nachdem ich Nageleisen und Spaten verstaut hatte, nahm ich einen großen Schluck Wasser und schulterte den Rucksack. Die Sonne brüllte mich stumm an, wie einem die schiere Anwesenheit eines cholerischen Schinders Terror im Kopf verursacht. Meine Beine waren ganz schwach. Die Sprunggelenkte fühlten sich an, als wären sie aus Gummi, als könnten sie jeden Moment einfach umbiegen. Mir war dabei ganz und gar nicht einerlei zu Mute. Jeder Tritt auf die geröllübersäte Flanke des Berges geriet zu einem Vabanquespiel. Reiß Dich zusammen, konzentriere Dich! Mein Hirn arbeitete im roten Bereich: schau hin, schau genau hin, wo Du hintrittst, immer auf festen Boden, in die Zwischenräume zwischen den Geröllbrocken, nie auf kleinere Steine, bloß nicht stürzen, nichts brechen, das wäre äußerst ungünstig…! Die innere Anweisung peitschte meinen Körper, der eigentlich so gerne nachgegeben hätte, zur Raison. Ich wagte nicht, zum Auto hinunter zu blicken – meinem Ziel. Nach ein paar Minuten setzte ich mich nieder, holte den Spaten aus dem Rucksack und benutzte ihn als Stütze. Von da an ging es etwas besser.
Immer wieder sah ich weiße Knochen herumliegen. Große, völlig ausgebleichte Knochen, an denen nichts Organisches mehr dran war – das pure, fossile Kalzium. An den Enden lagen die Poren der schwammartigen Zellstruktur offen. Diese Knochen waren überraschend schwer, steinhart und oft der Länge nach gerissen, wie verwittertes Holz. An einigen hatten sich Spuren orange-gelblicher Flechten angesetzt – was die extreme Trockenheit eben so zuließ. Ich fragte mich, wie alt diese Knochen wohl sein mochten. Ein paar Jahre oder Jahrzehnte? Jahrhunderte? Oder noch mehr? Und zu welchen Gattungen diese Ober- oder Unterschenkelröhren einst gehört hatten. Rind? Kamel? Pferd? … Mensch? Ich steckte zwei Exemplare ein – einen kürzeren geraden und einen längeren, schön gebogenen mit einem beeindruckend geformten Gelenkkopf. Vielleicht würde sich in Deutschland jemand finden, der ihr Alter bestimmen konnte. Vielleicht hatte ich ja Glück, und diese Knochen waren ein paar tausend Jahre alt…
Der Berghang wurde flacher, der Abstieg leichter und ich konnte wieder an andere Dinge denken. Ans Essen beispielsweise. Ich hatte Hunger. Eine letzte Konservendose gab es noch: Hühnernudeltopf. Die würde ich mir warm machen. Die Vorstellung beflügelte meine Schritte. Am Bus angekommen machte ich mich sofort daran, alles herzurichten. Den Gaskocher schon in der Hand, kam mir aber auf einmal ein ganz anderer Gedanke. Jetzt Hühnernudeltopf zu essen wäre eine Schande! Du bist jetzt hier, vielleicht das einzige Mal in deinem Leben. Du müssest eigentlich zu Nomaden fahren und mit ihnen essen. Es wenigstens versuchen. Wie kann man denn in der Mongolei gewesen sein ohne wenigstens einmal die Nomaden besucht zu haben? Sie sind doch für ihre Gastfreundschaft berühmt. Sie werden dich sicher… Genug! Ich brauchte nicht weiter hinzuhören; der Gedanke leuchtete mir augenblicklich ein. Auch wo ich es versuchen würde, wusste ich schon.
Ich trieb den Bus zurück Richtung Grenze, fuhr aber bereits nach wenigen Kilometern rechts ab, eine Staubpiste in die Steppe hinein. Zwei Nomandenfamilien siedelten hier am Weg. Die fernere der beiden schien die größere zu sein. Als ich mich der ersten näherte, nahm ich das Gas weg und fuhr im Schleichtempo vorbei – als ob ich mich verirrt hätte und irgendetwas suche. Es gab hier kaum Tiere. Das schien mir ungewöhnlich. Als wäre das hier eine Jurte, die man absichtlich abseits des Geschehens platziert hatte. Zwei kleine Jungen kamen herbeigelaufen. Ich ließ das Fenster herunter. „Schokolad!“ riefen sie. Wie in Tansania, dachte ich. In der Seitentür hatte ich ein wenig bittere Schokolade und brach ihnen zwei Stückchen davon ab.

Aus der einzigen Jurte kam gebückt eine noch junge Frau. Vielleicht die Mutter. Komm, komm! winkten die Kinder mir zu. Die Frau blieb an der Jurte stehen und schaute mich mit einem schwer zu deutenden Blick an. Er hätte einladend aber genauso gut abweisend sein können. Auch sah ich nirgendwo einen Mann. Deshalb beschloss ich, während die Kinder hinterherliefen und fortwährend Schokolad! riefen, erst einmal bis zum nächsten Lager zu fahren. Das befand sich nur 500 Meter weiter und bestand aus drei oder vier Jurten, die in recht großzügigem Abstand zueinander errichtet waren, so dass zwischen ihnen viel Raum blieb, auf dem grüppchenweise etliches Vieh herumstand oder am Boden lagerte. Ich hielt unaufdringlich etwas abseits, stieg aus und tat, als würde ich mich ganz zufällig hier umsehen. Da war einiger Betrieb im Lager. Kinder liefen umher. Zwei Frauen saßen auf Schemeln und molken Ziegen, die in einer langen Doppelreihe, versetzt, mit den Köpfen einander zugerichtet, hinter den Hörnern zusammen gebunden waren, so dass die Frauen von hinten an die Euter kamen. Zwei junge Kerle in Trainingsanzügen rauften miteinander. Ein Hund erhob sich und trollte mit eingezogenem Schwanz von A nach B, als wäre er auf der Suche nach etwas Unbestimmtem. Zwei ältere, rote Motorräder standen auf Seitenständern neben einer Jurte. Ein älterer und ein jüngerer Mann spazierten herüber zu mir. Der ältere mochte Mitte bis Ende Fünfzig gewesen sein. Er trug ein kegelförmiges Anglerhütchen aus hellem Stoff und einen alten grauen Troyer mit geöffnetem Reißverschluss. Im Ausschnitt am Hals schaute darunter ein zweiter, ein blauer Pullover hervor. Obwohl der Mann der kleinere von beiden war, zeigten sein Blick, die leicht nach hinten gebogene Haltung (Brust raus) und seine hinter dem Körper verschränkten Arme, dass ihm dieser ganze Besitz hier gehörte. Sein etwas jüngerer Begleiter hielt sich dezent im Hintergrund und lächelte ehrerbietiger. Er trug einen schwarzen Lederparka, darunter eine dunkelblaue Trainingsjacke aus Polyester und auf dem Kopf ein beiges Militärkäppi mit dem Schriftzug „Jeep“. Beide hatten schwarzes Haar, sonnengegerbte, bronzebraune Haut und waren glattrasiert, wobei die letzte Rasur beim Älteren schon ein paar Tage zurück lag.

Er deutete mir mit einer breiten Geste an, ihr Gast zu sein. Seine Augen waren an den Rändern rot unterlaufen und ich nahm an, das Alkohol sein ständiger Begleiter war. Mit einem Mal hatte ich gar keine Lust mehr, hier einzukehren. Plötzlich schien mir der Blick der Frau an der ersten Jurte doch ein einladender gewesen zu sein. Ich schüttelte den Kopf, wies auf irgendeinen Punkt und fuhr zurück. Doch da war keiner mehr. Keine Schokolad!-rufenden Kinder, keine Frau – nichts. Eine Geistersiedlung. Was soll’s, sagte ich mir und machte erneut kehrt. Sollten sie doch trinken – ich wollte die Nomaden nicht nur aus Interesse besuchen. Ich war auch schlicht am Ende meiner Kräfte. Mein Kopf tat weh, hämmerte und stach, mir war schwindelig, meine Haut brannte und schien mit ihrer Aufgabe als Hülle vollkommen unzufrieden; der ganze Körper fühlte sich geschlagen an. Ich brauchte dringend Energie.
II
Es scherte mich nicht, was man von mir denken könnte, weil die andere Siedlung in Sichtweite lag und viele Augen mein sinnloses Herumgekurve mit verfolgt haben dürften. Ich stieg aus und ging geradewegs auf den Patriarchen zu. Ein paar Jungs begrüßten mich sogleich und schritten neben mir her. Vielleicht war man tatsächlich froh über die Abwechslung. Vielleicht waren meine Bedenken, dass hier ununterbrochen westliche Abenteuer-Touristen vorbeischneiten und allen mit ihrem kulturinteressierten Getue auf die Nerven gingen, falsch und eine Täuschung, die aus zu vielen Fernreisedokus herrührte. Ich hatte unglaublichen Durst. Das Wasser im Auto half nicht mehr, ihn zu stillen. Ich schien das, was ich brauchte, weder zu haben noch zu kennen.
Der Patriarch führte mich zuerst zu seinen Ziegen. Die Frauen waren immer noch am Melken und grinsten mir kurz zu. Die augenfällig wichtigste unter ihnen – offenbar die Frau des Patriarchen – eine beleibte Fünfzigerin mit rotgeblümtem Kopftuch, einem leuchtgrünen T-Shirt unter roter Strickweste, buntem Hosenrock und starken, fleischigen Oberarmen, molk auf ihrer Seite wohl an die vierzig Ziegen; ein junges Mädchen hatte auf der anderen Seite von ebenso vielen schon etwa die Hälfte geschafft. Auch ich sollte einmal melken, deutete die Ältere an. Es ging ganz einfach. Nach ein paar Spritzern in den Eimer zog der Chef mich weiter. Das hier war Frauenarbeit.

Ich sah mir das Vieh an. Hauptsächlich Ziegen, Pferde und wieder diese Rinder mit seltsamen Gesichtern und langer, dichter, sandfarbener Wolle, die ich schon an der Grenze gesehen hatte. Die Rinder muteten so fremd an, dass ich erst dachte, es handele sich um eine unidentifizierbare Mischgattung – eine Art urtümliches Schafziegenrind. Wie das Vieh hier so lagerte und rundherum bis weit in die Steppe und auf die Berge hinauf verteilt war, da musste ich wieder an Abraham denken. So wird es damals gewesen sein, in der Bronzezeit… Ich beneidete die Nomaden. Wenn ich all den westlichen Schrott aus meinem Hirn herausbekommen könnte und keine sinnlosen Träume, keine unerfüllbaren Wünsche, und nicht diese ganze verfaulte Gier nach Dingen wie Konsum, Ruhm, Anerkennung, Wissen und Lust in mir haben würde – wenn ich ohne all das und ohne davon überhaupt etwas zu ahnen hier so leben könnte: mir dünkte, das musste ein ganz wunderbares, zufriedenes und sinnerfülltes Leben sein. Aber so war ich nicht. Es würde nicht einfach aufhören, wenn ich hier leben würde. Ich würde all das, was ich in diesem Moment als unbrauchbar verwarf und sogar hasste, unendlich vermissen. Aus dem Westen zu stammen schien zu bedeuten, zur Ruhelosigkeit verurteilt zu sein. Ich machte Fotos.
Der Hund war schon länger neugierig auf mich, kam nun näher, zögerte aber dann. Ich rief ihm etwas Aufmunterndes zu und hockte mich hin. Da traute er sich. Ich streichelte ihm den Kopf, was ihm sehr gefiel. Da kam einer der Jugendlichen mit breiten Schultern, schimpfte böse auf den Hund ein, nahm einen faustgroßen Stein und warf ihn aus kürzester Entfernung mit aller Kraft nach dem Hund. Als müsse er mich, den Gast, aus einer absolut unannehmbaren Situation befreien. Der Hund lief davon, blieb stehen und blickte sich nach mir um. Da kam ein zweiter Stein geflogen. Der Hund verstand. Im Gegensatz zu mir: wie konnte der Halbstarke das tun? Wie konnte er so herzlos der Kreatur gegenüber sein? War er vielleicht etwas zurückgeblieben (denn sein Gesicht sah nicht besonders intelligent aus)? Hatte er nicht gesehen, dass ich den Hund von mir aus hergebeten und gestreichelt hatte? Wie ich später herausfinden musste, hatte es nichts mit alledem zu tun: der Hund wurde von jedem hier so behandelt. Ich unterdrückte meine Empörung und ließ sie machen. Der Hund aber tat mir entsetzlich leid. Er half ihnen bei der Arbeit. Bewachte vielleicht sogar das Lager. Und dann als Dank das…
Von der östlichen Hügelkette herab kam ein Junge ins Lager geritten. Es war der selbe, der schon einmal, am frühen Nachmittag, meinen Weg gekreuzt hatte. Der Patriarch erklärte mir mit Gesten, dass nun Abend sei und das Vieh von seinen Weidegründen auf den Bergen zurück ins Lager getrieben würde – die Aufgabe des Jungen. Dieser hatte ein schmales Auge und ein schielendes. Sein Kopf mit dem kurzen, schwarzen, gleichmäßig in alle Richtungen abstehenden Haar und sah aus wie eine Distelblüte. Oder ein großer Rasierpinsel. Er hatte vom Reiten gerötete Wangen, kleine abstehende Ohren und blickte trotz seines Alters von höchstens sieben Jahren skeptisch wie ein Großer – Stirn in Falten, Mund zusammengekniffen. So saß er da oben, als wäre ihm das vertrauter als das Laufen auf seinen eigenen Beinen, die wegen ihrer Kürze seitlich vom Rumpf des Tieres abspreizten. Eigentlich sah er lustig und niedlich aus, wäre da nicht dieses Selbstbewusstsein und eine sichtbar unerschütterliche innere Stärke gewesen. Sein Beinahe-Verwachsensein mit dem vermeintlich viel zu großen Pferd ließ mich verblüfft schmunzeln. Der Alte rief ihm etwas zu. Der Junge schwang sich herunter und reichte mir mit verkniffenem Gesicht die Zügel. Ich sollte wohl auch mal auf’s Pferd. Dann sah man, dass das Pferd zu klein für mich war und der Alte gebot dem Jungen, ein anderes zu holen. Der Junge aber schüttelte den Kopf. Irgendetwas gefiel ihm daran nicht. Letztlich musste ich also doch auf dieses Pferd, dessen Zügel – ein einfaches Seil – ich immer noch in der Hand hielt. Nun schienen die beiden Bedenken zu haben, ob ich es denn auf das Pferd schaffen würde. Der Junge zeigte mir, wie ich es machen solle, denn es gab keine Steigbügel. Ich dachte mir, ich werde euch schon zeigen, dass ich auf dieses Pferdchen hinaufkomme, machte einen Sprung, stützte mich auf wie am Stufenbarren, schwang das rechte Bein drüber – und saß. Der Alte nickte zufrieden. Weil ich bereits vorher fotografiert hatte, winkte er nun mit der Hand und machte ein Klick-Zeichen neben dem Auge: gib mir deine Kamera! Ich zeigte ihm, wo der Auslöser war – und bekam ein schönes Foto von mir auf dem Pferd. Der Junge führte mich ein wenig über den Platz. Dann wollte er selber wieder reiten. Mir war es recht, denn ich hatte entsetzlichen Hunger und Durst. Meine Hose, meine Jacke – alles war durchgeschwitzt und wieder angetrocknet. Alles rieb und klebte. Die Muskeln schmerzten. Länger zu reiten wäre kein Vergnügen gewesen. Zumal ohne Sattel.
Die Halbstarken übten sich – beide die Hände auf den Schultern des anderen – schon wieder im Ringkampf. Ein anderer Junge schraubte an einem der Motorräder herum und probierte den Kickstarter. Mein Gastgeber führte mich zu seiner Jurte. Die war innen viel geräumiger, als man von außen annehmen konnte. Außer der Unterseite des Daches war die Jurte innen restlos mit bunten Tüchern und Teppichen ausgekleidet. Rot als Grundton dominierte; darauf gab es dann Muster in allen möglichen Formen und Farben. Rot mit Dunkelblau, Rot mit Hell- und Dunkelgrün, Rot mit Gold, mit Hellblau, Orange, Lila mit Leuchtpink, Schwarz und Leuchtgrün und so weiter. Es gab Fransen, Quasten, Kreise, Karos, Lilienmuster, persische und buddhistische Motive. Das Ganze sah geradezu verschwenderisch bunt und ausgesprochen freundlich aus. Ein größerer Kontrast zur kargen Außenwelt war kaum denkbar. Auf dem Boden lag Wachstuch. Fliederfarbenes, kariertes Küchenwachstuch wie zu Omas Zeiten. Darüber einige kleine Teppiche in Bettvorleger-Größe. Vier Schlafstätten befanden sich an je einer halben Wandseite. Das waren leicht erhöhte, mit Teppichen und leuchtend bunten Decken behangene Kojen, die sehr gemütlich aussahen.

Der Mann zeigte auf eine und machte mir verständlich, dass ich heute Nacht hier schlafen könne. In der Mitte der Jurte befand sich ein kleiner, niederer Ofen aus schwarzem Eisenblech, dessen Rohr durch eine mit Alu eingefasste Öffnung in der Dachhaut der Jurte führte. Ich schob einen der Wandteppiche zu Seite und blickte dahinter. Die Außenhaut der Jurte wurde getragen von jägerzaunartigen Wandelementen – kreuzweise verstrebten, etwa anderthalbfingerdicken, goldbraunen, ungehobelten aber über die Jahre glatt und speckig geschliffenen Holzgerten – und einer Dachkonstruktion aus ebenfalls langen, elastischen Holzstreben. Da man hier nirgendwo Bäume sah, vermutete ich, dass das Holz für die Jurten eine Anschaffung fürs ganze Leben und sehr wertvoll war. Vielleicht bekommen es junge Paare zur Hochzeit, dachte ich, aus den wenigen mongolischen Gebieten, in denen Bäume wachsen…
Neben dem Eingang hing ein Gewehr an der Wand. Ich trat davor und betrachtete es. Der Patriarch nahm es vom Haken und reichte es mir. Es war ein alter, klappriger Militärkarabiner. Maximal zweiter Weltkrieg. Lauf und Schaft waren mit Klebeband aneinander befestigt. Am Vorderschaft hatte er die hintere Gabel eines Fahrradrahmens angeschraubt – als Zweibein, zum ruhigeren Liegendschießen. Ich musste grinsen. Er erwiderte das Grinsen und schien unheimlich stolz auf seine Waffe. Was er denn damit jage, fragte ich. „Wolk“ – also Wolf – antwortete er auf Russisch. Ich erkundigte mich nach der Zahl der Wölfe, die er schon erlegt hatte. Er zeigte es mit den Fingern. Ich habe die Zahl vergessen, aber es waren viel mehr, als man diesem Gewehr zugetraut hätte.
Auch wenn es mir peinlich war, aber ich hielt es nicht länger aus. „U was jehst pietch“ – haben sie zu Trinken? – bat ich. „Ja chatschu pischu“ – ich muss trinken. Und meine Augen fügten hinzu: unbedingt! Der Mann zögerte nicht, und gab seiner Frau, die just in diesem Moment die Jurte betreten hatte und Milch aus einem Blechgefäß schöpfte, Bescheid. Man deutete mir, Platz zu nehmen, an einen Tisch, der zwischen Ofen und den Schlafkojen stand und aussah, als wäre er direkt aus der Kinderspielecke eines Einkaufszentrums importiert worden: eine hellblaue Wachstuchdecke mit roten, grünen, weißen und pinkfarbenen Kreisen. Die Frau stellte mir eine Tasse hin, dazu Zucker, einen Löffel und eine Kanne mit dem Milchgetränk. „Schto eto?“, fragte ich, während ich den Zucker einrührte. „Ayran“, antwortete sie. Tatsächlich wird sie vermutlich Airag gesagt haben. Das ist vergorene Stutenmilch, ein Getränk der mongolischen Nomaden. Da ich das aber nicht wusste und Ayran verstanden hatte, dachte ich mir nichts weiter und trank. Wie es schmeckte wäre mir in diesem Moment egal gewesen. Aber es schmeckte gut. Vor allem mit Zucker. Sie füllte mir gleich ein zweites Mal ein. Wieder trank ich aus. Ein drittes Mal. Dann trat sie aus der Jurte. Meine Kopfschmerzen und das Flirren in den Zahnwurzeln ließen bereits nach. Bald darauf kam das Mädchen herein, das mitgemolken hatte. Es begann, den Ofen mit getrocknetem Viehdung anzufeuern. Ich warf einen Blick hinein: eine feine Glut! Das Mädchen stellte Wasser auf. Nach einer Weile gab es Milch oder „Ayran“ hinzu und setzte Tee an, indem es eine ganze Ladung davon in den Kessel warf, mit einer großen Kelle umrührte, immer wieder etwas herausschöpfte und es dann aus der Höhe langsam zurück goss. Ich hatte schon vom Milchtee der Mongolen gelesen – davon, dass sie ihn auf eine ungewöhnliche Art zubereiten: nämlich mit Salz. Und dass dieses Getränk für unsereinen vorsichtig ausgedrückt einen sehr gewöhnungsbedürftigen Geschmack besitzen sollte. Da mein unmittelbarster Durst nun gestillt war hoffte ich, ich würde von diesem besonderen Tee verschont bleiben. Eine Weile verfolgte ich jede Handlung des Mädchens mit Unbehagen. Würde es Salz zugeben? Eine Schale mit einem weißen, kristallinen Pulver hatte es schon bereit gestellt. Ich versuchte mir einzureden, wenn es Salz wäre, dann brauche mein Körper möglicherweise genau dieses. Rückführung durch die Anstrengung verlorener Mineralstoffe und so… Doch am Ende war auch dieses grobkörnige, weiße Kristall Zucker. Ich glaube, ich trank in der Folge soviel, wie die ganze Familie zusammen. Die hatte sich nämlich, während der Tee im Kessel warm wurde, nach und nach am Tisch eingefunden, wobei der Junge mit dem schielenden Auge auf einem einfachen Smartphone herumzutippen begann. Nicht zu fassen, dachte ich, dass so ein Nomaden-Knirps ein Smartphone hat. Als ich ihn über dem Ding fotografierte, drehte er seinen Kopf hoch und schaute mit dem selben furchtlosen und gleichzeitig verkniffen-skeptischen Blick in die Kamera, wie er vom Pferd herunter geschaut hatte.

Die Frau des Hauses (bzw. der Jurte) tischte auf: eine Art in Öl gebackene Teigröllchen und dazu Trockenkäse in verschiedenen Ausführungen. Eine Sorte war von außen so hart wie Haselnüsse und geformt wie gelbliche Korallen. Die Stückchen lagen in einer Schüssel wie Keksgebäck. Dann gab es noch eine Schüssel mit Sahne oder Quark und einen Teller mit bunten Bonbons. Es war ein einfaches Mahl, aber ich habe zugelangt, als wäre ich lange krank gewesen und müsse nun endlich wieder genesen.
III
Draußen setzte die Dämmerung ein. Noch einmal bot man mir ein Nachtlager an. Ich hatte es aber schon anders beschlossen, denn ich musste davon ausgehen, dass der Grenzübertritt wieder viele Stunden lang dauern würde. Also wäre es gut, sehr weit vorn zu stehen. Das bedeutete: ich musste heute noch an die Grenze fahren (die ja täglich am Nachmittag schloss) und versuchen, eine gute Startposition für den morgigen Kampf zu ergattern.
Dennoch wollte ich mich nicht einfach aus dem Staub machen, sondern mich für die Aufnahme irgendwie bedanken. Der ganze Clan begleitete mich zum Bus. Der Alte und der etwas jüngere Mann, ihre beiden Frauen, die zwei Halbstarken, ein ziemlich aufgeweckter etwa zehnjähriger Junge, zwei Mädchen, etwa 13 und 15, der schielende Junge und zwei oder drei Kleinkinder. Dort wurden erst noch einmal Fotos gemacht. Unglaublich: den ganzen Tag schon zeigte der Akku meiner Camera nur noch einen Strich Ladezustand an. Ich hatte wie gesagt das letzte mal Strom in Aktasch gehabt, an der Garage des Katastrophenschutz. Seitdem hatte ich unzählige Fotos gemacht. Normalerweise ging es ab einem Strich Ladezustand sehr schnell zu Ende. Doch der Akku hielt und hielt. Es war ein Wunder.
Zum ersten Mal sah ich die ganz kleinen Kinder. Unglaublich süße Dinger mit großen dunkelbraunen Augen. Das ältere, forschere der Mädchen, nicht das, das den Ofen angeheizt hatte, setzte die Kleinsten zu sich auf ein Pferd – los, mach ein Foto von uns! Eines der Kleinen begann zu weinen. Das forsche Mädchen sprach mich plötzlich auf Englisch an. Wie ich denn die Mongolei finden würde? Ich sagte sehr schön. Seine Mutter erklärte, es würde auf die Schule gehen – als einzige der Familie. Auf Russisch meinte das Mädchen, es würde gut Englisch können. Na los, forderte ich es auf, sag‘ was auf Englisch. Stolz, mit einem breiten Strahlen entgegnete sie: „Welcome to Mongolia! Mongolia very good!“ Ich wollte noch mehr hören, aber das war alles, was sie auf Englisch sagen konnte. Welcome to Mongolia und Mongolia very good, dachte ich, und wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Aber vielleicht hatte sie einfach nur Recht und ich war mit Gedanken schon wieder zurück an der Grenze, das heißt im Westen, so dass ich es gar nicht mehr begreifen konnte.
Während ich einige große Stücke von verschiedenen Trockenkäsesorten verstaute, die mitzunehmen man mich gedrängt hatte, versuchten die jungen Leute durch die Scheiben in meinen Bus zu schauen. Ich öffnete die Schiebetür. Jetzt war ich plötzlich der Zampano. Was ist das? Und das? Und das? wollten sie wissen. Ich räumte einen Teil meiner Ausrüstung heraus und ließ sie alles begutachten. Dann demonstrierte ich meine Benzinlampe. Als das Licht erstrahlte und dazu das beruhigende Zischen ertönte, jubelten sie, als hätte ich einen Zaubertrick vorgeführt. Nun, dachte ich, mal sehen, wie euch das gefällt, und öffnete die Heckklappe. „Gitarra!“ riefen das forsche Mädchen und „Velossiped!“ der aufgeweckte Zehnjährige und seine älteren Brüder oder Cousins. Ich gab dem Mädchen die Gitarre, die es gleich ganz geschickt hielt, und holte für den Jungs das Rad aus dem Bus. Mein Rad… Vielleicht kurz ein paar Worte dazu. Es war ein 28er Trekkingrad mit Ballonreifen. Also eigentlich ein 29er. Und es besaß einen Stahlrahmen in Übergröße, der eine Sonderanfertigung war. Ich hatte es gebraucht von einem 1,95m-Typen gekauft. Auf den kleinen Rahmen, die Räder heutzutage fast alle haben, sah man als großer Mensch meiner Meinung nach immer lächerlich aus. Deshalb der große Rahmen. Allerdings war dieser selbst mir (1,90m) ein oder zwei winzige Zentimeterchen zu hoch. Wenngleich das durchaus kein Problem darstellte und es mir eben sehr gefiel, endlich wieder ein meiner Körpergröße angemessenes Rad zu haben. Einzig von den Petalen abrutschen durfte man nicht. Das konnte weh tun.
Der Junge nun, der so begeistert Velossiped gerufen hatte, wollte unbedingt auf dem Rad fahren. Er war keine 1,70 m und konnte nicht einmal selbst aufsteigen, geschweigedenn im Sitzen fahren. Das Rad musste also etwas zur Seite geneigt werden, damit er über die Stange kam; dann hielt ich es am Gepäckträger, bis er in die Petale gefunden hatte, schob ihn an und er stürmte davon. Ich werde es nie vergessen: Er fuhr im Stehen, bei einsetzender Dämmerung, und brüllte vor Glück. Seine Jubelschreie drangen von weit draußen in der Steppe her zu uns, wobei man ihn zeitweise gar nicht mehr sah, so dunkel war es schon geworden. Als er vollends beglückt zurückkam, wollte einer der größeren Jungs fahren. Doch dieser tat es bei weitem nicht mit der gleichen Begeisterung und drehte auch nur eine kleine Runde. Derweil kam der andere mit zwei Pferden zurück. Auf dem einen saß er. Das andere war für mich. Er wollte mit mir über die Steppe reiten.
Na gut, dachte ich, auch diesen Gefallen tue ich dir. Da ich aber im Grunde überhaupt keine Ahnung vom Reiten hatte bat ihn, nicht so schnell zu machen. Nachdem ich oben saß – wieder: keine Steigbügel, kein Sattel, nicht einmal eine Decke – einfach nur auf dem Pferderücken, das Zügelseil in den Händen – ritten wir zunächst in langsamem Tempo los. Doch der Junge war ein Wirbelwind, ein Wildfang und ein richtiges Luder. Mit seinem Seil gab er meinem Pferd immer wieder eins auf’s Hinterteil und zischte dazu „tschju-tschju!“, so dass es bald in einen Trab verfiel, der für mich schon die Obergrenze des Erträglichen darstellte. Es wurde ja auch immer dunkler… „Stop!“ rief ich dem Jungen zu. Er lachte, und gab meinem Pferd ordentlich eins drüber. „Tschju!“ Nun wurde es richtg schnell und ich begann das Beten. Die Hufe donnerten auf dem harten Boden. Balance halten, rief ich mir zu, und Stop! dem Jungen, der umso lauter und fröhlicher lachte, je angstvoller ich Stop rief. Zack! Noch ein Schlag für mein Pferd. Es flog über die Steppe. (Bitte lass mich nicht alle meine Knochen brechen, bitte nicht vom Pferd stürzen!) Ich war voll im Selbsterhaltungsmodus, konzentriert bis ins letzte Härchen. „Stop!“ brüllte ich hemmungslos, zog die Zügel an und brachte mein Pferd allmählich zum Stehen. Der Junge machte „brrrr“ und ließ nun, schnaufend vor Glück, ebenfalls nach und wandte sich zur Umkehr. „Paschalsta…“, keuchte ich. „Tschju! Tschju!“ rief er lachend und trieb mein Pferd mit dem Seil an. Sauhund! Im Galopp ging es wieder zurück. Meine Muskeln waren aufs äußerste gespannt, der Nacken hart wie Fels. Irgendwie oben bleiben, war das Gebot der Stunde. Beten und oben bleiben. Und heil wieder ankommen. Neben mir der Junge lachte. Er freute sich unendlich. Vielleicht dachte er, er würde mir etwas Gutes tun. Nahe des Lagers rief er „brrrr“, verlangsamte sein Tempo, dem sich mein Pferd angepasst hatte, und wir trabten locker zur am Bus versammelten Mannschaft. Als ich abstieg war mit von der Anspannung kotzübel. Und noch etwas spürte ich deutlich: ich hatte mir den Hintern wund geritten. Es brannte wie Feuer. Der Junge lachte immer noch, sprang vom Pferd, schnappte sich mein Velossiped und verschwand wieder in der Dunkelheit. Ich bat die älteren Jungs, noch einmal auf ihren Mustang-Motorrädern zu fahren, damit ich sie so fotografieren könne. Nachdem auch das geschehen war und der Wildfang-Junge mir mein Rad mit der Geste einer vorsichtig dankbaren Verbeugung übergeben hatte die besagte, er wisse, dass es nun endgültig vorbei sei, verstaute ich alles, winkte allen zu, winkte ihrem Winken zurück und brach auf. Es war Nacht geworden. Im Westen glomm der letzte Rest eines orangenen Streifens unterm dunkelblauen Firmament.
IIII
Der Bus flog über das Schotterbett. Ein grobes Fahrzeug hatte ihm Querrillen eingeprägt. Im seltsam warmen Scheinwerferlicht ratterte das Negativ der Ketten als Spiel aus Licht und Schatten unter mir hindurch.
R-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d…
Dröhnend, hypnotisch. Ich wurde leer. Dann musste ich an den Hund denken. Immer wieder hatte er im Laufe des Abends meine Nähe gesucht. Immer wieder hatte man ihn vertrieben – mit großen Steinen und harschem Worten. Vielleicht war ich der einzige Mensch, der jemals freundlich zu ihm gewesen ist. Oder sein wird… Und dennoch. Du warst bei den Nomaden… Ach ja… Ich seufzte und streckte die Hand nach dem Käse aus. Gut verpackt in Küchenpapier. Mein Schatz…
Da vorn war die Grenze. Viel früher, als ich gehofft hatte, begann die Autoschlange. Ich reihte mich hinten an, stieg aus und bestimmte meine Position. Vorne standen einige Wagen in zweiter Reihe, deshalb konnte ich es nicht genau sagen. Irgendetwas zwischen Platz 20 und 25. Damit musste ich zufrieden sein. Mehr war nicht drin. Schon eine Stunde später bewertete ich meine Lage ganz anders, denn die Schlange war hinter mir um mindestens zehn weitere Autos, darunter einige Tanklastzüge, angewachsen.
Zum ersten Mal seit Deutschland fühlte ich mich wirklich unsicher. Ich hatte das untrügliche Gefühl, dass mein Hab und Gut hier von begehrlichen Blicken beobachtet wurden und ich beispielsweise mein Rad keinesfalls draußen stehen lassen durfte. Ebenso fürchtete ich mich davor, im Zelt zu schlafen. Die heruntergekommene Grenzklitsche ernährte sicher auch zwielichtige Gestalten. Hier lebten ja keine Nomaden vom Vieh, sondern Sesshafte von solchen, wie mir. Ich sah nur eine Möglichkeit: mit dem Rad im Bus zu schlafen. Also stapelte ich mein Gepäck so an den Bordwänden auf, dass für mich selbst in der Mitte eine Mulde blieb und ich das Rad quer obendrüber legen konnte. Das war eine enge und sperrige Angelegenheit, die ich überdies fast vollständig im Dunkeln bewerkstelligte, damit keiner von außen beobachten konnte, wie genau ich es mir im Inneren einrichtete. Ich legte mir mein großes Messer, Pfefferspray und eine Taschenlampe griffbereit. Dazu noch eine leere Wasserflasche, damit ich zum Austreten nicht den Bus verlassen musste. Als all das getan war und ich mich endlich zum Schlafen ausstreckte, als ich ruhig wurde und die Gedanken zu schweifen begannen, musste ich wieder an Sascha denken. Alles war im Fluss, die Wasser mächtig. Wohin würde es uns treiben? (…Sascha… hoffentlich…)
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.





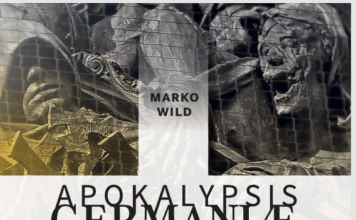

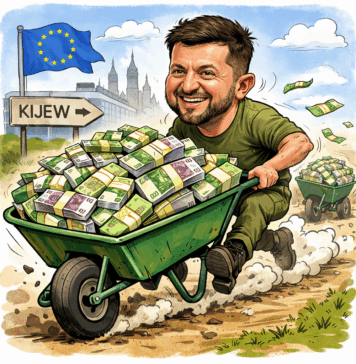

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.