Russland Safari – Ein Fortsetzungsroman von Marko Wild

IIII
Meine Freude über den Aufbruch ans Ende der Welt, nach Taschanta, dem letzten Punkt, den die Landkarte vor der Grenze zeigte, währte nur kurz. Schon einen Kilometer nach Aktasch wurde die Straße einspurig; Baukolonnen frästen den alten Asphalt ab, planierten Schotter und Kies und verpassten der M52 einen amtlichen Belag. Bald schon würde es hier aussehen, wie geleckt. Nur eben noch nicht jetzt. Männer in orangefarbener Warnkleidung spritzten das Straßenbett aus Wassertanks nass, damit es in der sengenden Hitze nicht so sehr staubte. Die Russen fuhren nicht gerade zimperlich über den Kies. Das zwang mich, größere Abstände zu den Vorausfahrenden einzuhalten, damit mir die Frontscheibe nicht von herumspritzenden Steinchen zerschlagen wurde. Was wiederum jene hinter mir motivierte, mich zu überholen. Was wiederum ich nicht zulassen wollte, da jeder Überholvorgang ebenfalls mit heftigem Steinchengespritze einherging. Während ich also auf der kurvenreichen Straße links alle Angreifer im Auge zu behalten versuchte, nahm mich gleichzeitig der Anblick rechts gefangen. Hier zeigte sich die Tschuja-Schlucht hier besonders wild und farbenprächtig. Sumpfige Überschwemmungsflächen des mäandernden Flusses, teilweise zugewuchert mit Schilf, Strauch- und Buschwerk wechselten mit allerlei bunten Gräsern, Disteln und Blumen, unterbrochen von kurzer, moorähnlicher Vegetation. Hinter der nächsten Kurve plötzlich Tundra – loser, offener Wald aus dürren, spitz-gezackten Lärchen. Dann wieder Birken. Dazwischen Oranges und Gelbes. Und Felsen, eingebettet in Dickicht, das bis auf Brusthöhe reichte.
Bärenland, dachte ich.
In der Ausweichstelle einer engen Kurve stand ein Nadelbaum, der untenherum mit hunderten bunter Zetteln behängt war. Zuerst glaubte ich, der Wind sei in eine Müllhalde gefahren und. Doch dann erinnerte ich mich: hier ließ man seine Wünsche zurück und vertraute sie wer weiß wem an. Dem Schicksal. Dem Himmel. Allah. Buddha. Oder jemandem, den man nicht kannte. Ralph hatte mir davon erzählt.
Es ging bergauf. Jede Kurve mehrte mein Staunen über die mannigfaltige Natur. Das waren 20 Kilometer von extremer landschaftlicher Verdichtung. Sascha, mit einer Sonnenbrille, die kein bisschen weiblich aussah, lehnte am Seitenfenster und war gedanklich sonstwo. Noch eine Kurve. Wir erreichten jetzt 1500 Meter Höhe. Plötzlich weitete sich das Tal. Kaum noch Bäume. Alles Grün erschien nun in einem helleren Olivton. Die Farben ähnelten Saschas Camouflage-T-Shirt. Kurzes, hartes Steppengras bedeckte die Hänge der sanften, welligen Erhebungen, die sich bis tief ins Land hinein zogen. Dahinter – ein Blick an Sascha vorbei, zur anderen Seite heraus – Die Berge. Ich jauchzte auf: „Hey dort drüben! Sieh dir das an!“
Da waren sie wieder, die schneebedeckten Gipfel. Endlich ganz frei einzusehen. Der Gebirgszug durchzog den gesamten rechten Horizont. Die M52 dagegen führte geradewegs auf zwei Steppenhügel zu, die, die anderen welligen Erhebungen überragend, wie zwei Spalier sitzende Löwen den Eingang zum Dahinterliegenden markierten. Ein Wahnsinnspanorama. Auch Sascha wurde richtig lebendig. Ich hielt an. Warnblinker ein. Wir stiegen aus, gingen auf der Straße umher, breiteten die Arme aus und fotografierten uns gegenseitig vor dem Horizont. Wir machten Faxen, blödelten, schrieen. Welch eine Freiheit! Ein Russe, den ich auf dem schlechten Abschnitt abgehängt hatte, überholte uns wieder. Und noch einer. Mit jedem Auto, jedem menschengemachten Geräusch, empfand man noch viel stärker, wie leer es hier war! Wie trocken. Und wie unglaublich schön! Ich hätte es nie für möglich gehalten, wenn ich nicht selbst da gewesen wäre.
Was hinter den beiden Hügeln kam, war die Kuraijskaja Step – eine Senke in Gestalt eines Auges, 20 mal 20 Kilometer breit. Sie ruhte im gebirgigen Relief des Hohen Altai wie eine Schale, die man in den Boden gedrückt hatte. Die Kuraijskaja Step war der am weitesten nach Westen hinein reichende Flecken mongolischen Klimas. Ein Dornröschen, das noch keiner wachgeküsst hatte. Mitten im „Auge“, sozusagen am oberen Rand der Pupille, lag die Siedlung Kuraij, von der die Steppe ihren Namen hatte. Wir fuhren nur hindurch und auf der anderen Seite des Auges, im – wenn man so will – „Tränenwinkel“ in ein Tal hinein. Das letzte seiner Art. Noch einmal, wenn auch zaghaft, wuchs die vertraute Altai-Vegetation von Süden her bis an die Ufer der Tschuja. Zu unserer Linken ein Bollwerk leuchtend roter Felswände. Sie erinnerten mich an Bilder aus Arizona. Irgendetwas sagte mir, dass es hier Gold geben musste. Dann fuhren wir aus dem Tal heraus, auf 1800 Meter über dem Meer – und alles Bekannte war nicht mehr. Zum ersten Mal sah alles wirklich ganz anders aus. Ich hatte den halben Kontinent durchfahren, die ganzen 7000 Kilometer, und war bis hierher gekommen. In ein Land ohne Wald, ohne Wiesen, ohne Felder. Sicher hatte ich schon viel gesehen. Sicher hatte alles seinen eigenen Charakter gehabt. Und dennoch war nirgends etwas gewachsen, das nicht auch so oder so ähnlich überall auf meiner Reise oder in Deutschland selbst hätte wachsen können. Wie oft hatte ich gestaunt! Aber was ich sah, war nie wirklich fremdartig gewesen. Vielmehr musste die Entfernung von daheim meinen Blick befreit haben. Wuchsen nicht auch in Deutschland Lupinen und drei Meter hohe Herkulesstauden? Hatte ich sie nicht schon gesehen? Natürlich! Nur nie wirklich wahr genommen. Und ähnelte der Ural nicht dem Bayerischen Wald hinter Deggendorf? Die Waldaihöhen, jene lichtdurchflutete Allee vor Kasan, auf der der Franzose vor uns hergefahren war, Tatarstan, die westsibirische Ebene. Ähnliche Zutaten, verschieden zubereitet. In Wahrheit waren es überall Birken, Linden, Erlen, Pappeln, Fichten, Lärchen, Kiefern, Eichen, war es überall Gras, Getreide, Mais, waren es Sonnenblumen, Heidelbeeren, Kräuter, Disteln, Hagebutten, war es Farn, Edelweis und Löwenzahn gewesen. Selbst der alttestamentlich anmutetende Abschnitt im mittleren Altai – er hätte auch in den Hohen Tauern, an der Großglockner Hochalpenstraße liegen können.
Seit der Kuraijskaja Step, die nur ein kleiner Vorgeschmack gewesen war, erst recht aber hier, nach dem letzten Tal mit Bäumen, hatten wir all das endgültig hinter uns gelassen. Vor uns lag etwas gänzlich Anderes, etwas Unvergleichliches . . . die große Ebene der Tschuijskaja Step, die sich bis an die mongolische Grenze erstreckte. 95 Kilometer lang und 40 Kilometer breit.
Von der Siedlung Ortolijk, am Anfang der Steppe, bis Kosch-Agatsch, der Hauptstadt des gleichnamigen Raijons, bildete die Tschuja ein kleines Binnendelta. Der Boden war sumpfig, wies immer wieder pfützenartige Seen auf, Wasserlachen, an denen oft Schilf wuchs. Vieh lief ungehindert herum. Ich sah die ersten Kamele. Kosch-Agatsch selbst war der Sonne vollkommen schutzlos ausgeliefert. Kein Baum, kein Nichts, das hätte Schatten spenden können. Die Häuser standen kreuz und quer auf dem steinigen Boden. Es gab keine befestigten Wege. Kein Gleis, nichts Gepflastertes, nichts Asphaltiertes. Nur ausgefahrene Pisten. Und die Fernstraße – den Tschuijskij Trakt, die M 52. Viele Dächer waren aus türkisfarbenem Wellblech oder Kunststoff. Offenbar die Farbe der hier lebenden Kasachen. Alle Leitungen verliefen oberirdisch. Hunderte Masten, Mikadoland. Und Werbetafeln. 70 Jahre irgendwas. Diesmal nicht das Kriegsende. Groß, bunt, hässlich. Erinnerungen an süd- und osteuropäische Trabantenstädte kamen auf: Beton mitten in der Landschaft. Als wir an einem Lebensmittelladen vorbei fuhren fragte ich mich, ob und wann wir wohl Adrian wieder überholen würden. Niedrig über uns flog ein großer Raubvogel mit langen, eleganten Handschwingen. Ich erwischte in perfekt im Flug . . . mit der Kamera, während der Fahrt, aus dem Fenster! Kosch-Agatsch verabschiedete sich durch krakelige Tentakel aus Stahl, mit Satellitenschüsseln . . . Militär, dachte ich. Dann begann die große Trockenheit: die eigentliche Tschuijskaja Step.
„Was ist das? Wie nennt sich das?“, wollte ich von Sascha wissen und hielt ihr die Karte hin. Sie musste mir helfen, das Wort auszusprechen. Ich begriff nicht, dass Tschuijskaja sich von der Tschuja herrührte, der wir nun ungefähr schon seit Inja folgten, also ungefähr dort, wo ich Adrian wieder ausgeladen hatte. Die Tschuijskaja Step war nicht so „schön“ wie die Kuraijskaja Step. Aber sie nahm einem den Atem. Hier konnte man auch den Verstand verlieren, wenn es ganz dumm lief.
Die M52 hatte jetzt keine Kurven mehr. 55 Kilometer lang führte sie mitten durch die Steppe, schnurgerade von Nordwest nach Südost. Bis Taschanta. Man sah die Berge im Osten, dort, wo die Mongolei sein musste. Aber sie kamen nicht näher. Auch im Süden begleitete uns das Hochgebirge. Weiße, graue und braune Gipfel, die neben uns herzulaufen schienen, wie ein langsamer Film. Die Steppe war vollkommen eben, wie ein Tisch. Ohne ein einziges Hindernis, ohne einen Anhaltspunkt für das Auge. Voller faustgroßer Gesteinsbrocken, gleichmäßig verteilt, als ob ein sagenhafter Gigant alles zermörsert und breitgestrichen hätte. Dazwischen wuchs Gras. Ich hatte so etwas noch niemals zuvor gesehen. Wie weit mochte es bis zu den nächsten Bergen sein? Fünf Kilometer? Zehn? Wie lange würde man zu Fuß dahin brauchen? Die Karte gab mir später Auskunft: es waren etwa 4 Kilometer nach Süden und zwischen 12 und 25 Kilometern nach Norden – je nachdem, ob man die Hügel ansetzte, die sich 400 m hoch wie grüne Dünen aus dem Land wölbten, oder die jenseits davon liegenden, 3.500 m erreichenden, graubraunen Berge, die mit den Wolken Licht und Schatten spielten.
A propos: da braute sich was zusammen. Dicke, schwere Cumulus-Wolken begannen sich über den Bergen zu sammeln und hoch aufzutürmen. Noch strahlten sie hell. Ein Blick zurück aber zeigte: hinter uns hatte sich der Himmel bereits verdunkelt. Dort, wo ich Kosch-Agatsch vermutete, fiel ein schwerer, grauer Wasserteppich aus den Wolken. Erstaunlich schnell, diese Wetterveränderung … Wir hatten 30 Kilometer Vorsprung.
Ich musste anhalten. Die Weite auf mich wirken lassen. Ich öffnete die Tür. Keine Autos. Kein Geräusch. Ich setzte den Fuß auf den Asphalt (diese Stille), stieg aus. Es war unglaublich. (Ob es hier Gold gibt, hier, auf der Ebene? So dass man sich nur bücken und es aufzulesen braucht?) Ich verließ die Straße. Zum ersten Mal spürte ich die Höhe. Nur ganz leicht. Es war einem einfach nicht mehr nach Herumspringen zumute. Seit Kosch-Agatsch hatten wir weitere 200 Höhenmeter überwunden. Völlig unbemerkt. Ich blickte zurück. Was immer das da hinten sein mochte – noch war es weit weg. Da kam ein Wind. Hui, starker Wind. Nur eine Bö. Aber meine Feldjacke hatte geflattert. Sascha war im Bus sitzen geblieben. „Schau mal zurück!“, rief ich. „Es wird Regen geben!“ Mit der Fußspitze auf dem Boden: Kein Gold, das man einfach auflesen konnte. (Hatte ich das wirklich erwartet? Dann würde sich doch keiner hier eine Ziege halten.)
Immer gerade aus. Der Horizont kam langsam näher. Ich war verzaubert. Kosch-Agatsch, Aktasch, Kysyl-Tasch, Kurai, Taschanta, Tschuja, Katun. Was für Namen, was für Klänge. Taschanta, Taschanta … Der Ort hatte längst eine mythische Bedeutung für mich. Warum? Es gab keinen vernünftigen Grund. Also musste es etwas mit Unvernunft zu tun haben, oder? Denn es war ja überhaupt nicht vernünftig, so weit zu fahren, um … Ja, um was? Warum war ich hier? Ich hatte mich das schon gefragt. Aber keine Antwort gefunden. Im Moment interessierte es mich auch nicht. (Taschanta!) Die Stadt war schon zu sehen. (Du Stadt in den Dünen der Steppe …) Dreizehn Kilometer noch. Pi mal Daumen.

Wenige Minuten später überholten wir einen Radfahrer. Ein echter Mensch! In dieser Wüste. Kurz vor Taschanta! Er fuhr auch gegen den Wind an, der stark zugenommen hatte. Der Radfahrer war klapperdürr, hatte braune Haut, einen an der Spitze angegrauten, schwarzen Vollbart, trug eine schwarze Sonnenbrille, eine schwarze Regenjacke, eine schwarze lange Hose, schwarze Schuhe und ein – ha! – beigegraues Käppi mit Nackenschutz. Sein schwarzes Rad trug fünf schwarze Gepäcktaschen. Keine Frage, der Mann mochte Schwarz. An einem Spanngummi über dem vollgestopften Gepäckträger hatte er zwei Fähnchen befestigt: ein russisches und ein türkisches. Schon vorbei gefahren musste ich dann doch anhalten. Wir hatten bereits einige Radreisende überholt. Die meisten schienen Russen gewesen zu sein, oft in kurzen Turnhosen. Und Militär-Sonnenhüten. Dieser hier unterschied sich.
„Wohin des Wegs?“, rief ich ihm gegen den Wind zu. Englisch funkzanierte.
„Taschanta. Ulaan-Bator. Vielleicht Wladiwostok.“
Der Radler hieß Bilkin, war etwa so alt wie ich und kam aus der Türkei.
„Türkei!? Bist du aus der Türkei mit dem Rad bis hierher gefahren?“
„Ja.“ Er grinste. Wahnsinn, wen man unterwegs so traf.
„Ich wette, du bist der einzige Türke, der sowas macht“, meinte ich.
„Nein“, erwiderte er, „es gibt schon noch einige.“
„Aha? Wieviele denn?“
„Na, so sieben oder acht.“
Ich brach in Lachen aus. „Sieben oder acht!?“ Nur Verrückte auf diesem Planeten.
Ich erzählte ihm von Adrian, der auch in Taschanta über die Grenze wollte. Dann: Fotos gemacht, hab auf dich Acht, Gott zum Gruße, mein türkischer Freund … „Man sieht sich an der Grenze wieder. Vielleicht. Und ..: Regen kommt! Sieh mal nach hinten!“
Bilkin musste noch eine Weile kämpfen, die letzte Steigung hinauf nach Taschanta.
Wir hingegen waren endlich da.
V
Keiner der sonst oft so stolz und pompös modellierten Namenszüge hieß uns willkommen. Nur ein paar schlichte, zur Spitze eines Halbmondes gebogene Stahlrohre, die ein Schild trugen:
p. ТАШАНТИНКА,
weiß auf blauem Grund. Reka Taschantinka also, ein Bächlein, von dem die Grenzstation ihren Namen hatte, unterquerte an dieser Stelle den groben Asphalt des einsamen Tschuijskij Trakt. Hinter dem Schild grasten Kälber. Das eigentliche Ortsschild stand ein paar Meter weiter noch bescheidener in der Pampa. Hier endete die große Ebene. Taschanta lag am Fuß der Berge, 2100 Meter über dem Meer. Auf der Nordseite erhoben sich „Dünen“ (ich muss sie einfach so bezeichnen, es gibt keinen passenderen Ausdruck) direkt hinter der Siedlung. Südlich vom Bächlein, von uns aus gesehen also rechts, begannen die Hügel erst jenseits der Grenze. Taschantas erstes Gebäude war eine kleine Moschee. Quadratisch, weiß- getünchte Mauern und ein hellblaues Dach mit silbernem Blech-Halbmond – so empfing sie uns links oberhalb der Straße, alleinstehend, mitten in der Steppenweide. Weit, weit darüber, vom obersten Rand der „Dünen“ herab, verkündeten große, weiße Lettern: 70 let pobjedyj – siebzig Jahre Sieg. Taschanta war ein Kaff von ca. fünfzig Häusern, entlang der Straße. Die Hälfte davon (z.T. hölzerne) Kaschemmen, Motels, Saunas – sogar ein Friseur. Alles, was am Ende der Welt halt so gebraucht werden könnte. In den anderen Häusern wohnten vermutlich die Grenzbeamten und einige wenige Einheimische. Gebaut wurde auch. Überall lag Material herum, Bewehrungsmatten, Ziegel, Kipplaster fuhren hin und her und blockierten die enge M52. Am oberen Siedlungsende dann der Staat – breit, weiß und blau: die Grenzstation. Hier war Schluss mit lustig. Wir reihten uns in die Warteschlange ein, irgendwo zwischen Position zwanzig und dreißig. Das ging. Es war um Vier. Ein paar Positionen vor uns zwei Reiseenduros aus Kitzingen (KT). Die Biker hatten ihre Helme abgenommen und saßen in voller Montur an einem Metallzaun auf der Weide. Ich fühlte ich mich seltsam gehemmt. Verspürte überhaupt kein Bedürfnis, hinzugehen und Hallo zu sagen. Deutsche Biker waren nicht das, was ich hier zu treffen wünschte – warum auch immer. Alles mussten sie betreten und „erobern“, diese Deutschen. Überall mussten sie „auch schon einmal da gewesen“ sein. Wie der Igel im Märchen. Da fuhr man 7000 Kilometer weit weg. Und was traf man? Am Ende der Welt? Deutsche.
Vorne ging nichts. Keine Bewegung. Das Eisentor war verschlossen. Leute spazierten auf der Straße, gingen nach Taschanta, um etwas zu Essen und sich frisch zu machen oder standen in Grüppchen herum und unterhielten sich. Bald hatte Sascha den Grund für die allgemeine Siesta herausgefunden: die Grenze war seit vier Tagen geschlossen. Wegen Feiertagen in der Mongolei. Gerüchteweise sollte sie morgen Früh um 9 Uhr wieder geöffnet werden. Genaues wusste niemand. Alle waren in die Sackgasse gefahren. Wer weiß, wie lange einige schon warteten. Ede und Stens oranger MAN war nirgends zu sehen. Auf ihrem Blog las ich später, dass sie unterwegs von der geschlossenen Grenze erfahren und gleich eine alternative Route eingeschlagen hatten. Der Vorteil einer Satellitenverbindung. Welch eine glückliche Fügung, dass wir in Aktasch „aufgehalten“ worden waren.

Die Wolken waren jetzt da und machten alles bleigrau. Wind pfiff, Staub tanzte. Was würden die Biker machen, falls das hier richtig losging? Anscheinend hatten sie den gleichen Gedanken, denn sie fuhren ihre Maschinen auf die Weide und begannen, zwischen Kühen und einem Fußballtor, ein Zelt zu errichten. Keine Minute zu früh. Sprühregen setzte ein. Sascha meinte, sie müsse unbedingt eine richtige Toilette finden, etwas hygienisches, mit Waschbecken und so. „Willst du mein Regencape?“ fragte ich. Es war das erste, das sie von mir annahm. Dann sappte sie los, mit ihren Trekkingsandalen, gebeugt, Waschbeutel in der Hand, Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Wir würden uns also bis Morgen früh die Zeit vertreiben müssen. Wegfahren konnten wir nicht, dann wäre die gute Position futsch. Ich schaute mich um. Links standen Häuser. Ganz vorn war die Baustelle. Dahinter ging es sofort steil bergauf. Ich ließ den Blick schweifen über die offene, rechte Seite. Unterhalb der Straße, im Gras, ein langer sumpfiger Graben mit großen Steinen. Und Wasser. Hier trank das Vieh. Dahinter flache Weide, zwei Fußballtore ohne Netz. Die Biker waren gut. Ihr Zelt stand schon. Mit etwas Abstand zwei Radfahrer. Sie bauten auch ein Zelt auf. Plane flappte im Wind. Ich holte mein Fernglas heraus. Tatsächlich: Adrian und Bilkin. Da hatten sich zwei gefunden. (Leichter Schwenk nach links.) Ahh, die Grenze … breit aufgepflügte Erde. „Todesstreifen“ oder was? Doppelzaun mit Stacheldraht, mehrere Meter hoch. Eine echte Grenze … wie früher. Soweit das Auge reichte. Wer hätte das gedacht. Entlang der Grenze eine Piste hinauf in die „Dünen“. (Ich fuhr sie mit dem Auge ab.) Rechtskurve, um ein Gatter herum, mehrere Hektar groß. Gatter mit Zaun. Zaun mit Tor. Tor war offen. Ja, da konnte man hinein gehen. Oben wieder heraus, in das nächste. Dazwischen ein Gang zum Viehtrieb. Darunter … das gibt’s doch gar nicht! Unter dem Grenzzaun durch. Auf die andere Seite. Es war offen. Jenseits endlose Steppe. Weit hinten, auf halber Höhe, kleine Punkte. Das mussten, das konnten doch bloß … Kamele. Man könnte also einfach, falls einen keiner sah, falls man es clever anstellte …
Ich wusste, was ich zu tun hatte. Der Regen war schon wieder vorüber – ein Güßchen, nicht der Rede wert. Da hatten die Wolken nach mehr ausgesehen. Sascha kam zurück.„Ich werde mal ein bisschen spazieren gehen“, sagte ich.
„Ja, mach nur. Ich warte im Auto.“
Zwanzig Minuten später schlüpfte ich durch den Gang zum Viehtrieb auf die andere Seite der Grenze. Vorsichtig, mich immer wieder umsehend. Doch niemand nahm Notiz. Kein Alarm ging los. Kein Geländewagen von der Grenzstation, der sich erbost in Bewegung setzte. Ich dürfte auch kaum zu sehen gewesen sein. Zu weit weg von der Straße war das hier. Die andere Seite war ein Traum. So oder so ähnlich musste sich der erste Mensch auf dem Mond gefühlt haben. Es gab hier schlicht und ergreifend: nichts. Außer Steindünen mit Steppengras. Und diesem Geruch, der die ganze Luft erfüllte und mir schon auf dem Weg hier hoch aufgefallen war: frisch und süß und würzig. Ein bisschen nach Minze. Was war das bloß? Bald fand ich das Kräutlein, von dem er ausging. Es spross hier überall. In Büscheln, so groß, wie ein halber Fußball. Die jungen Blätter waren hellgrün, die älteren blaugrün und sahen aus, wie winziger Farn, in Fraktalen gefiedert und extrem hübsch. Ich rupfte etwas ab, rieb mir Gesicht und Hände damit ein und steckte den Rest in die Jacke. Mal sehen, ob es Sascha auffallen würde.
Die Grenzstation war von hier oben perfekt einzusehen. Auf mongolischer Seite wartete kein einziges Auto. Seltsam. Wenn wir also morgen nur kurz rein fahren würden, um uns den Stempel im Pass abzuholen, und dann gleich wieder heraus, wäre das eine Sache von höchstens einer Stunde. Nach der Grenzstation schlängelte sich die Straße zwischen den „Dünen“ bergauf und entzog sich im Niemandsland meinem Blick. Die Kamele konnte ich mit dem Fernglas jetzt noch besser erkennen. Sie sogar zählen. Aber sonst? Hier gab es nur Himmel und Erde. Und mich winziges Menschlein inmitten eines gewaltigen Ozeans, dessen Wogen sich aufgetürmt hatten und in der höchsten Bewegung erstarrt waren. Ich legte mich hin, um die Erde zu spüren. Und ganz nahe an diesem Geruch zu sein. Ein Vögelchen flog auf und landete sogleich wieder in meiner Nähe. Als wolle es spielen. Diese dröhnende Stille, dieser harte, warme Gesteinsboden mit den duftenden Kräuterbüscheln. Wenn die Erde weiblich war, dann lag ich gerade an ihrem Busen. Sascha musste das unbedingt sehen. Überhaupt: die Wolken zogen sich wieder mächtig zusammen. Vielleicht war das vorhin nur eine Andeutung gewesen. Es würde nicht mehr lange dauern. Schnell zurück.
 Adrian und Bilkin arbeiteten fiebrig. Ich hastete. Kaum saß ich wieder im Auto, begann es zu schütten wie aus Eimern. Es krachte und rumpelte – soetwas nannte man wohl ein ausgewachsenes Gewitter. Und was machte mein wundersames Mädchen aus Orel? Sascha stieg aus und stellte sich mit hängenden Schultern neben dem Bus. Nach vier Sekunden klebte ihr Camouflage-T-Shirt klatschnass am Körper. Ich sah sie nur von hinten, verschwommen durch einen Film aus Glas und Wasser, war mir aber sicher, sie hatte die Augen geschlossen und lächelte. Bauarbeiter stellen die Bewehrungsarbeiten ein und flüchteten von der Baustelle in durchsichtigen Capes. Auf der Weide bildeten sich kleine Seen. Nachdem das Gewitter vorbei war, blieb der Himmel bedeckt und die Luft kühl. Sascha behielt – warum auch immer – die nassen Klamotten an. Ich sah, dass ihr kalt wurde. „Hier, zieh das bitte an!“ Ich hielt dem zitternden Mädchen mit den Gänsehautarmen meinen Bundeswehr-Pullover hin. Diesmal war es ein freundlicher Befehl. Den Sascha auch widerspruchslos ausführte. Ich lud sie zur Exkursion auf die andere Seite ein. Oben, hinter dem Grenzzaun, machte wir ein paar Fotos. Dann: Cameravergleich. Saschas hatte den größeren Zoom, die bessere Auflösung, die besseren Programme, eine bessere Farberfassung, mehr Speicher, eine bessere Audioaufnahme bei Videos – ein Superteil. Sie machte die bei weitem besseren Fotos. Ja, meinte Sascha, die Camera sei das einzige, was sie sich geleistet habe. Umgerechnet 300 Euro – ihr gesamtes Weihnachtsgeld sowie ein Teil des Gesparten für diese Reise hatte sie dafür ausgegeben. Die Camera war ihr einziger, wirklicher Luxusgegenstand. Sie hing sehr daran.
Adrian und Bilkin arbeiteten fiebrig. Ich hastete. Kaum saß ich wieder im Auto, begann es zu schütten wie aus Eimern. Es krachte und rumpelte – soetwas nannte man wohl ein ausgewachsenes Gewitter. Und was machte mein wundersames Mädchen aus Orel? Sascha stieg aus und stellte sich mit hängenden Schultern neben dem Bus. Nach vier Sekunden klebte ihr Camouflage-T-Shirt klatschnass am Körper. Ich sah sie nur von hinten, verschwommen durch einen Film aus Glas und Wasser, war mir aber sicher, sie hatte die Augen geschlossen und lächelte. Bauarbeiter stellen die Bewehrungsarbeiten ein und flüchteten von der Baustelle in durchsichtigen Capes. Auf der Weide bildeten sich kleine Seen. Nachdem das Gewitter vorbei war, blieb der Himmel bedeckt und die Luft kühl. Sascha behielt – warum auch immer – die nassen Klamotten an. Ich sah, dass ihr kalt wurde. „Hier, zieh das bitte an!“ Ich hielt dem zitternden Mädchen mit den Gänsehautarmen meinen Bundeswehr-Pullover hin. Diesmal war es ein freundlicher Befehl. Den Sascha auch widerspruchslos ausführte. Ich lud sie zur Exkursion auf die andere Seite ein. Oben, hinter dem Grenzzaun, machte wir ein paar Fotos. Dann: Cameravergleich. Saschas hatte den größeren Zoom, die bessere Auflösung, die besseren Programme, eine bessere Farberfassung, mehr Speicher, eine bessere Audioaufnahme bei Videos – ein Superteil. Sie machte die bei weitem besseren Fotos. Ja, meinte Sascha, die Camera sei das einzige, was sie sich geleistet habe. Umgerechnet 300 Euro – ihr gesamtes Weihnachtsgeld sowie ein Teil des Gesparten für diese Reise hatte sie dafür ausgegeben. Die Camera war ihr einziger, wirklicher Luxusgegenstand. Sie hing sehr daran.
„Dein Pullover ist wirklich schön warm“, räumte sie auf dem Rückweg ein. „Ich glaube, das ist etwas, das ich mir auch einmal zulegen werde.“
Ach nee…
VI
Am Abend. Sascha hatte sich erkundigt. Ein Mann – Kasache oder Russe – hatte ihr versichert, mit dem Ausweis über die Grenze zu kommen, sei kein Problem. Sie würde also mitkommen. Sehr schön. Jetzt warteten wir in der Schlange, saßen – sie, die Tür auf, vorne, ich, die Schiebetür auf, hinten – im Bus und aßen.
„Kann ich mal dein Messer haben?“, fragte sie.
„Selbstverständlich.“ (Was war denn heute mit ihr los?) „Ich sage es doch: ein Messer muss man immer dabei haben. Du solltest dir nicht nur einen Pullover, sondern auch ein Messer kaufen. Du siehst ja, dass du eines brauchst.“
„Ganz sicher nicht.“ Da war er wieder, dieser abfällige Ton.
„Riechst du was?“
„Mm-hm, gut.“ Klang nicht sehr überzeugend. „Was ist es?“
Ich hielt ihr ein Zweiglein hin.
„Das wächst da oben überall. Riech mal. Ich habe mir das Gesicht damit eingerieben. Wenn die Kühe das fressen – das muss eine unglaubliche Milch geben.“
Sascha lächelte. Das Lächeln einer Mutter gegenüber einem Kinde.
„Wie wollen wir es überhaupt heute Nacht machen?“, wechselte ich das Thema, „willst du wieder draußen schlafen? Im Biwacksack?“
„Ich weiß nicht.“
„Also ich hab‘ keine Lust, das Zelt aufzubauen. Falls es weiter so regnet… Wir könnten auch beide im Bus schlafen. Platz wäre genug. Vorausgesetzt es macht dir nichts aus und du kommst auf den Vordersitzen zurecht. Für mich ist das dort zu eng.“
„Nein, ist okay.“
Die Wolken waren noch nicht fertig. Zum dritten Mal ballten sie sich zusammen. Diesmal wollten sie es wissen. Blauschwarze Nacht, obwohl es noch gar nicht so spät war. Es sah nach Weltuntergang aus. Der entscheidende Schlag stand bevor. Ich setzte mich nach vorn und schloss alle Türen und Fenster. Wir waren gewappnet. Als es losbrach, das heißt: als draußen Gewitterhölle und Sintflut gleichzeitig entfesselt wurden, als Sturzbäche die Straße herunter flossen und Taschanta vermutlich die Hälfte seines Jahresniederschlags abbekam, hockten Sascha und ich nebeneinander und machten es uns gemütlich. Sie zog ein Notizbuch heraus, begann zu kritzeln, legte es aber bald wieder ab und dachte nach.
„Worüber hast du geschrieben?“
„Was wir so erlebt haben. Damit ich es nicht vergesse.“
Sie schien nicht nur zu schreiben, sondern sich auch Skizzen zu machen.
„Kann ich mal sehen.?“
„Nein!“ Sie war empört.
„Ich kann doch eh kein Russisch.“
„Na und!“
Aus dem Notizbuch schauten bunte Seiten eines Magazins, herausgerissen und gefaltet, so oft, dass die Knicke schon ganz weiß waren.
„Was ist das?“
„Informationen.“
„Über hier? Altai?“
„Unter anderem.“
Sie hatte also doch mehr mit, als den einen Internetausdruck, war doch methodischer vorgegangen, als sie zugeben wollte. So ein Luder.
Ich machte das Radio an. Furchtbar. Anstatt mongolische oder kasachische Musik, spielten sie nervige westliche Pop-Kopien mit mongolischen oder kasachischen Saiten-Instrumenten und stampfendem, überbetontem Rhythmus. Dazu jodelte der oder die Sänger/in in einer Sprache mit sehr vielen Ös und Üs. „Überall die gleiche Scheiße“, dachte ich. Verärgert machte ich das Radio wieder aus. Schon in Zentralrussland, später auch in Nowosibirsk war mir aufgefallen, wie ungeheuer eintönig die Musik vieler Radiosender war. Von den – und das muss man wirklich sagen: Es gab sie! – positiven Ausnahmen abgesehen. Russische Pop-Perlen, mit Melodien. Hach… (Medlenno, Medlenno, doschd pa twjim gubam…)
„Doschd …“, sagte ich zu Sascha und zeigte aus dem Fenster.
Sie nickte.
„Ich kenne ein russisches Lied“, fuhr ich fort, langte nach hinten und holte die Gitarre. Dann spielte ich Sascha „Pod laskoij pljuschewowo pljeda“ vor.
„Ich kenne dieses Lied“, meinte sie. „Es ist ein sehr schönes Lied. Kannst du noch mehr? Spiel doch noch was.“
Ich spielte und sang zwei Lieder. Sascha lauschte. Dann fragte ich:
„Kannst du ein Instrument?“
Draußen ließ der Regen allmählich nach.
„Ich wollte auch mal Gitarre lernen.“, antwortete sie zögernd.
„Na los, hier, dann spiel du auch mal was.“
Sascha zupfte leise ein paar Arpeggios. Sie wusste auf alle Fälle noch, wie man Akkorde greift. Das Mädchen erstaunte mich immer mehr. Stille Wasser sind tief – wenn das je auf einen Menschen zutraf, dann auf Sascha. Ich hatte eine Idee. Ein Lied, von dem ich wusste, es würde ihr gefallen.
„Kennst du die?“ Ich reichte ihr eine CD von Skunk Anansie.
„Nein.“
Wie sollte sie auch. Die Band hatte ihre Zeit gehabt, als Sascha zwei, drei, vier Jahre alt gewesen war. Oh Mann, die Zeit. Ich legte „Infidelity“ ein, drehte schön laut, aber nicht zu sehr. Der Regen hatte fast aufgehört. Es war stockdunkel.
Ich hielt den Atem an. Besonders gespannt war ich auf die Stelle, an der der Bass einsetzte, nach dem ersten Refrain… Sascha blieb mucksmäuschenstill. Sechs Minuten und sechs Sekunden.
„Und?“, fragte ich, als es vorbei war.
„Gib mir das, die Hülle.“
Sie nahm das Cover heraus und fotografierte es.
„Und?“
„Ich werde mir das kaufen. Ich kaufe mir diese Musik. Gib mir deine CD.“
Sie fotografierte auch dieses Cover ab.
„Die kannst du aber nicht kaufen“, meinte ich. „Die gibt es nur direkt von mir persönlich.“
„Ich werde sie finden“, entgegnete sie selbstbewusst.
Da kannst du lange suchen, dachte ich. Die einzigen tausend Exemplare liegen bei mir zu Hause. Gut, mittlerweile waren es nur noch 600. Doch ich würde ihr eine schenken. Genau dazu hatte ich ja ein paar dabei, hinten im „Geldkoffer“. Schon lange hatte ich das beschlossen. Ich wollte nur noch den richtigen Moment abpassen. Und herausfinden, ob sie ihr wirklich gefiel. Jetzt wusste ich es. Außerdem machte Sascha Fotos vom Peter-Fox-Album „Stadtaffe“ sowie meiner „Best of Pankow“, die ich heute tagsüber eingelegt hatte. Besonders ersteres hatte es ihr angetan.
Das Musikhören hatte uns so dieser Dimension entrückt, dass mir erst jetzt wieder einfiel, wo wir uns befanden – in Taschanta, am äußersten Ende des Bekannten. Auf der anderen Seite lag das Niemandsland.
Ich stellte mein Rad ganz nah neben den Bus, damit man es von der Straße aus nicht sehen konnte und hoffte, keiner würde sich bis morgen daran vergreifen. Dann legten wir uns schlafen. Unsere erste gemeinsame Nacht im Bus.
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.




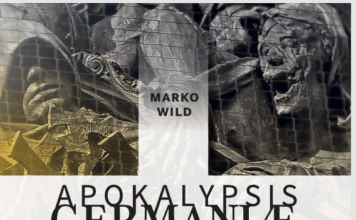


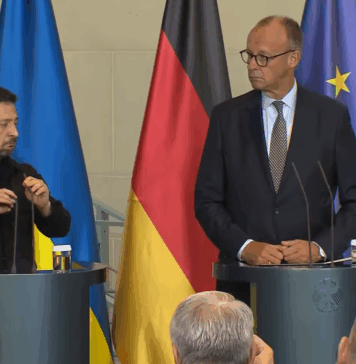

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.