
I
Heute also: Sein oder Nicht-Sein. Auto repariert bekommen, oder die Nachricht von einem Defekt erhalten, der meinen Russland-Trip beenden würde, noch bevor er richtig begonnen hatte. Ich war sehr angespannt. Dunja begleitete mich. Gemeisam mussten wir den Bus zu VW Tomsk buxieren. Nastja und Jewgeni holten uns ab. Jewgeni schloss die Halle auf: mein weißes Schiff schaute mich friedlich mit den Heckleuchten an. Alles noch dran. „Jewgeni, ich habe gestern wahrscheinlich mein Taschenmesser bei dir vergessen“, ließ ich ihm durch Dunja ausrichten. Ich hatte damit den Fisch zerteilt. Das Messerchen bedeutete mir viel, weil es mich schon lange begleitete und einen sehr schön gemaserten Griff hatte. Eifrig sprang Jewgeni die Treppe hoch und brachte mir das Messer zusammen mit meinem kleinen Wörterbuch. Er hatte alles schon bereit gelegt. Auf den Mann war Verlass. Der Tag begann vielversprechend.
Jewgeni zeigte uns am Computer den Weg: vom äußersten Nordosten mussten wir ganz runter in den Süden der Stadt, über den Tom, einen rechten Nebenfluss des Ob, und dann am Flussufer entlang bis zum Volkswagen Zentr Eurasia. Die Strecke Uliza Ivanovskowo – Entusiastov (schon wieder!) – Baltiskaja – Elizarovjik – Schegarskji Trakt verlief als Tangente am östlichen und südlichen Tomsker Stadtrand entlang. Das war sehr gut, denn nichts fürchtete ich mehr, als mit der lädierten Motorsteuerung durch die Innenstadt zu müssen, mit unzähligen Gangwechseln, Stopps und Beschleunigungen. Ich wollte den Bus wie ein rohes Ei zu Volkswagen bringen. Diese eine letzte Fahrt musste er noch durchstehen, ohne dass unter der Haube ein irreparabler Schaden entstand. Jewgeni zeigt mir zum Abschied noch einmal seine Goldzähne:
„Wenn du nach Tomsk zurückkommst, fahren wir zum Angeln in die Taiga!“
„Ja, das machen wir“, sagte ich. Wir reichten uns die Hand. Dann brach ich mit Dunja auf.
Es war bewölkt und kühl. Auch das war gut. Und: Jewgenis Werkstatt lag um einiges höher, als Volkswagen Zentr Eurasia. Zehn Kilometer lang ging es leicht bergab. Ich musste nur wenig Gas geben, konnte sogar oft auskuppeln und den Bus enfach rollen lassen. Dennoch: der pling!-Ton hatte sich noch einmal verschärft – er kam jetzt ununterbrochen: pling! pling! pling! pling! pling! pling! pling! Wenn der Bus es nicht schaffen sollte, wenn er einen Motorschaden davontragen sollte… Ich wollte gar nicht daran denken. Immerhin war das nicht nur mein Reisegefährt, sondern auch unser Familienauto. Meine Frau fuhr während der Zeit meinen Dienstwagen. Dunja sah mich an und sagte kein Wort. Ich krampfte das Lenkrad fest und redete dem Bus gut zu. Nacken und Oberarme waren so hart, dass es mir selbst auffiel; sie schienen ein gewaltiges Gewicht zu tragen. Bei jeder der Gott sei Dank wenigen Ampeln schickte ich ein Stoßgebet nach oben. Die meisten blieben oder wurden grün, als wir kamen. Nur ein einziges Mal auf der gesamten Strecke mussten wir anhalten – vor der Tom-Brücke. Kaum zu glauben: bis dahin konnten wir ohne Unterbrechung ganz langsam durchrollen.
Je länger die Fahrt dauerte, desto sicherer wurde ich, dass der Bus es schaffen würde. Als wir nach 20 Minuten auf dem Parkplatz von VW Tomsk anhielten, war ich erschöpft. Aber erleichtert: es war vollbracht. Dunja hatte uns am Morgen schon telefonisch angekündigt. Der Manager – ein schlanker, kurzhaariger Mann Mitte Dreißig, in fliederfarbenem Hemd und anthrazit-grauem Sakko – empfing uns, reichte mir die Hand und geleitete mich an einen Tisch, wo wir die Formalitäten ausfüllten: den Diagnose- und Reparaturauftrag. Dunja dolmetschte. Ich erbat einen Rückruf, wieviel die Reparatur kosten würde, bevor irgendjemand einen Schraubschlüssel ansetzte. Selbstverständlich, entgegnete der junge Manager.
Das Autohaus war hell, modern, mit großen Glasfronten und Vitrinen, in denen Artikel lagen, die zu Spontankäufen anregen sollten: Schweizer Taschenmesser, bestickte Mützen, edle Alufelgen, Pflegemittel. Es sah so gar nicht „russisch“ aus. Man behandelte mich freundlich und zuvorkommend und versicherte mir, zu tun, was man könne. Ich solle bitte den Schlüssel stecken lassen. An diesem Montag Vormittag gäbe es schon einige Aufträge – vor 15 Uhr solle ich nicht mit dem Rückruf rechnen. Und selbstverständlich könne man auch erst nach der Diagnose sagen, ob die Reparatur heute überhaupt möglich sein oder ob es eine größere Sache werden würde.
15 Uhr also… Bis dahin waren es noch einige Stunden. Dunja und ich fuhren mit dem Bus in die Stadt zurück. Die Busfahrt war absurd günstig, nur ein paar Kopeken. Ich zahlte für uns beide und kam mir ein wenig schäbig vor, weil ich nicht mehr für Dunja tun konnte. Zwei Stationen nach der Tombrücke stiegen wir aus und gingen zu Fuß zu meinem nächsten Ziel: einer Adresse namens Deutsches Haus Tomsk.
II
Am Samstag, als ich mir vor dem Besuch des Staryj Zamok den Weg dahin hatte zeigen lassen, war geschlossen gewesen. Heute bat uns das offen stehende Gartentor am weißen Bretterzaun wie ein stummer Portier herein. Auch die Eingangstür war geöffnet. Dunja und ich traten zögernd ein. Was war das? Ein Museum? Ein touristischer Anlaufpunkt? Menschen kamen uns entgegen. Eine junge Frau sprach mich an. Ich antwortete zunächst auf Russisch, dass ich Journalist aus Deutschland sei. Sie wechselte sofort auf Deutsch und fuhr mit starkem Akzent fort. „Bitte warten sie. Herr Heyer kommt gleich. Bitte nehmen sie hier Platz.“
Dunja und ich versanken in einem Ledersofa, in einem Foyer mit Parkettboden. Nach wenigen Minuten ging die Tür auf und festen Schrittes herein kam ein Herr um die 60, aufrecht, mit Hemd und Westover, hellem Blick und einer Glatze, die ihm darartig gut stand, als würde es so etwas wie Haare überhaupt nicht geben. „Guten Tag, ich bin Alexander Heyer, der Leiter des Deutschen Hauses“, sagte er und hielt mir seine Hand hin. Ich ergriff sie freudig. Es war eine Wohltat diesen Menschen in perfektem Hochdeutsch sprechen zu hören, so viele Kilometer von daheim. Das kam mir vor wie ein Wunder. Als wäre ich Zoologe und hätte endlich diese geheimnisvolle Tierart gefunden, von der man immer nur andere hatte reden hören. „Ich habe gerade etwas Zeit“, fuhr er fort, „oder besser gesagt: ich nehme sie mir. Denn das ist ja schön, jemanden aus der Heimat begrüßen zu dürfen.“ Bei diesen Worten stiegen wir eine Etage höher und kamen in seine Räumlichkeiten. Parkett, Schreibtisch – warm, offen, repräsentativ. Sehr schön. Dunja stand in ihrem orangeroten Kostüm zusammengesackt und unschlüssig hinter mir. Sie hatte nie eine selbstbewusste Haltung. Doch gerade sah sie besonders hilflos aus. Ich sagte: „Dunja, das hier dauert vielleicht eine Weile. Wenn du in der Zwischenzeit etwas erledigen willst…“ Sie war froh, nicht bleiben zu müssen. Ob ich sicher sei, dass ich allein zurecht käme? Ich nickte. Wenn ich fertig wäre, solle ich sie anrufen. Sie würde wieder hierher kommen und wir könnten das Auto abholen. Ich nickte nochmal. Dunja ging.
Alexander Heyer bat mich an seinen Schreibtisch, schob mir einen Stuhl zurecht, ging fort und kam zurück mit schwarzem Tee, zwei Tassen und einer Dose mit süßem Gebäck. „Gestern hätten sie mich nicht angetroffen“, begann er. „Da war ich noch in Nowosibirsk – ein Treffen mit einer Delegation von der deutschen Regierung. Ich bin gerade erst zurück gekommen.“

Das musste die Delegation sein, von der Gernot gesprochen hatte. Ich sah Alexander Heyer an . . . schwer vorstellbar, dass an Gernots Geschichte etwas dran war.
„Das ist ja lustig“, erwiderte ich, „denn auch ich hätte keine Stunde früher Zeit gehabt.“
Alexander Heyer lächelte und goss mir ein.
„Zucker?“
„Nein, zu den Keksen nicht.“
„Ja, nehmen sie nur, nehmen sie nur.“
Ich nahm.
„Also, was kann ich für sie tun?“
Ich erzählte ihm von meinem Vorhaben, den Wurzeln jener Russlanddeutschen nachforschen zu wollen, die nach Deutschland übergesiedelt waren. Dass ich herausfinden wolle, wie die Situation der noch hier lebenden Russlanddeutschen sei, ob es noch viele gäbe, wo und wie sie lebten, ob sie die deutsche Sprache oder einen alten Dialekt pflegten, wie es um ihre Religiosität bestellt sei, ob die, die noch hier lebten, diejenigen seien, die sich endgültig zum Hierbleiben entschieden hätten, wie ihr Verhältnis zu Russland sei und so weiter.
Alexander Heyer trank einen Schluck Tee, nahm ein einziges Kekslein und sagte dann: „Wir haben schon hin und wieder Besuch aus Deutschland, und wir freuen uns immer, wenn sich jemand wirklich für uns, für die Deutschstämmigen, interessiert. Dennoch ist es so, das unser Haus, das Deutsche Haus, im Laufe der Zeit mehr und mehr zu einem Anlaufpunkt für unsere eigenen Leute geworden ist. Wir versuchen hier ein bischen die Koordinationsstelle zu sein für die, die noch da sind. Und ja – viele derjenigen, die noch im Oblast leben – und wir haben in Tomsk eine der größten deutschstämmigen Gemeinden in ganz Sibirien, wesentlich größer, als in Nowosibirsk – viele werden vermutlich bleiben. Obwohl es immer noch vereinzelt welche gibt, die übersiedeln. Aber die großen Auswanderungswellen waren in den 1990er Jahren bis Anfang des neuen Jahrtausends. Wir werden weniger, definitiv. Und es ist ja auch so – viele Deutschstämmige heiraten Russen. Deren Kinder werden dann ganz automatisch Russen. Sie wachsen „russisch“ auf, sprechen nur noch Russisch…“
Er hob eine Hand, als wolle er nach etwas greifen, das dann doch nicht da war, ließ sie wieder fallen und machte ein So-ist-das-halt-Gesicht.
„Also könnte das jetzt möglicherweise die letzte Generation sein? In 20, 30, 40 Jahren wird es keine Russlanddeutschen mehr geben. Bedeutet es das?“
Alexander Heyer hob die Augenbrauen und wiegte den Kopf: „Ja. Irgendwann wird es uns nicht mehr geben. Schon jetzt können nur noch die allerwenigsten Deutsch sprechen.“
„Aber Sie sprechen ausgezeichnet Deutsch. Wie kommt das?“
Er erzählte, dass er lange als Dolmetscher gearbeitet habe, mehr zufällig da hinein gerutscht sei, weil er auch noch Englisch konnte. Wir unterhielten uns über Politik, ich erzählte von den Schwierigkeiten, den andauernden Reformen im deutschen Bildungsystem und fragte nach der Situation in Russland. Einst hatten Zar Alexander II und sein Vater, der vom humboldschen Bildungsideal fasziniert gewesen war, deutsche Lehrer und Wissenschaftler nach Russland geholt. Bildung nach klassischem deutschen Vorbild wurde selbst zu Sowjetzeiten hochgehalten. Alexander Heyer meinte, auch in Russland würden sich die Zeiten ändern; man merke ebenfalls eine allmähliche Zurückentwicklung, ein sinkendes Niveau der Inhalte, ein Überfrachten mit Spezialwissen.
„Ich wurde in Kasachstan geboren und besuchte dort zehn Jahre lang eine Dorfschule. Danach war ich so fit, dass mich jede Universität in St. Petersburg mit Handkuss genommen hätte. Das gibt es heute nicht mehr, dass man in so kurzer Zeit eine so gute Bildung erhält. Aber die jungen Leute sind heute auch ganz anders. Sie schauen nur noch, in welchem Beruf kann ich Karriere machen, wo kann ich am schnellsten das meiste Geld verdienen. Und dann studieren eben alle Ökonomie. Oder werden Bankkaufmann. Früher hat man versucht etwas zu lernen, das einem wenigstens ein bisschen Spaß machte, den eigenen Interessen entsprach. Doch heute haben die jungen Leute nur noch Geld und Karriere im Kopf.“
Ich dachte an Dunja, die in Tomsk einen technischen Beruf studiert hatte.
„Und, was ist in Deutschland los? Ich bin wirklich gespannt auf Informationen aus der Heimat.“
Ich erzählte von den politischen Stürmen, die durch Deutschland fegten, von neuen politischen Kräften und dem Widerstand, der sich dagegen regte. Davon, dass viele Firmen eigentlich gegen die Russland-Sanktionen wären, dass sich das Land immer mehr in zwei Lager zu spalten schien – in jene, die die Regierungspolitik gut fänden und jene, die das nicht täten. Vom Auseinanderdriften der Gesellschaften, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Alexander äußerte Bedenken wegen der militärischen Hochrüstung und dem anklagenden Ton aus Europa und fragte, wohin das alles noch führen solle. Deutschland und Russland seien doch eigentlich schon von der geografischen Lage her füreinander prädestinierte Partner. Ich erzählte vom kulturellen Wandel. Von Tabubrüchen, der forcierten Geschlechterdebatte und dem voll entbrannten Kampf um die Deutungshoheit in allen möglichen Themen. Alexander Heyer hörte interessiert zu. Hier und da warf ein ein erstauntes „Ach!“ oder ein ungläubiges „Das gibt’s doch gar nicht!“ ein und mir schien, dass man hier wirklich nur sehr wenig aus dem Land der Vorfahren oder überhaupt aus dem Westen mitbekam. Wir unterhielten uns völlig frei, schweiften ab, fanden wieder zurück, drehten noch eine Schleife und schienen im anderen jeweils den kongenialen Gesprächpartner gefunden zu haben. Eine wunderbare Unterhaltung. Nach all den aufwühlenden Ereignissen und Unsicherheiten der vergangenen Tage fühlte ich mich, als hätte ich eine Oase erreicht und würde frisches Wasser zu trinken bekommen.
Da klingelte mein Handy. VW Tomsk war in der Leitung – ein Stunde früher, als vereinbart. Ich verstand kein Wort und reichte das Telefon Alexander. Es konnte keinen besseren Dolmetscher geben, als ihn. Jede Frage, die mir mit Dunja zu klären unmöglich gewesen wäre, war mit Alexander als Übersetzer ein Kinderspiel. Der Mann hatte nicht nur selbst ein wenig Ahnung von Autos und wusste die korrekten technischen Begriffe, sondern er war auch regelmäßiger Kunde bei VW Tomsk und kannte den Manager persönlich. Ergebnis: im Motor meines Busses war ein Sensor locker geworden und meldete permanent falsche Daten, woraus die Elektronisch eine Überhitzung errechnete. VW Tomsk meinte, man könne den Sensor zwar nicht austauschen, aber festlöten. Sie fragten, ob sie das tun sollten. Die Kosten für Reparatur und Diagnose würden 4.200 Rubel betragen. Natürlich sollten sie es machen. Mein Auto würde wieder funktionieren – nur das zählte.
In Ordnung, kam es vom anderen Ende. In einer Stunde könne ich das Auto abholen.
Alexander bot mir an, mich selbst dahin zu fahren – er müsse dort ohnehin etwas besprechen. Ich telefonierte mit Dunja und gab ihr Bescheid. Gut, dann würden wir uns in der Wohnung von Tanja wieder treffen. Wieder etwas geklärt. Heute lief es wie am Schnürchen.
Die Tür ging auf. Ein junger Mann, nicht sehr groß aber muskulös wie ein Diskuswerfer, mit engem Shirt, das gleich zu platzen schien, Cargo-Hose, kurzen dunklen Haaren und noch dunkleren Augen, betrat den Raum. „Ah“, sagte Alexander, „Anton! Komm, hol‘ dir einen Stuhl, setz‘ dich zu uns!“
Er stellte mich ihm vor. Der junge Mann griff zu, schüttelte mir den Arm und grinste erfreut. Die ersten Minuten schwieg er und hörte uns beiden nur zu. „Anton ist aus Deutschland wieder zurück gezogen“, meinte Anlexander. Und an den anderen gewandt: „Erzähl doch mal ein bisschen von dir.“
So erfuhr ich – ebenfalls in einwandfreiem Deutsch – dass der Mann als Kind mit seinen Eltern aus Russland nach Deutschland übergesiedelt war. Aufgewachsen im Norden des alten Bundesgebietes war er immer damit konfrontiert worden, aus Russland zu stammen. Später diente er in der Bundeswehr und hatte gehofft, dies würde als ultimativer Integrationsbeweis anerkannt werden. Doch selbst dadurch und trotz seines perfekten Deutsch wurde er das Stigma des „Russen“ nicht los. Das störte ihn. Ein Besuch in Tomsk, die Freundlichkeit, mit der man ihn hier aufgenommen hatte und die Chance, sich hier sofort beruflich zurecht zu finden, hatten ihn dann dazu bewogen, mit Frau, Kind und Kegel wieder nach Russland zu gehen. Ein Schritt, den er noch keine Sekunde bereue. Viel besser sei es hier.
„Zieh doch mit deiner Familie auch hierher“, meinte er, nur halb im Scherz, „dann kannst du Lehrer werden und unsere Kinder in Deutsch unterrichten!“
Die nächste erstgemeinte Einladung nach Tomsk? Sollte das etwas zu bedeuten haben? Ich versprach, zumindest eine Mail zu schreiben, wenn ich wieder zu Hause sein würde. In einem sehr kleinem Kleinwagen fuhren wir zu VW Tomsk. Das Auto seiner Frau, blinzelte Alexander mir zu. Er selbst habe natürlich ein größeres…
Bei VW gab es keine Probleme. Der Fehler am Bus war behoben worden, die Reparatur kostete exakt soviel, wie vereinbart. Alexander, Anton und der junge Manager von VW Tomsk verabschiedeten mich und wünschten mir alles Gute. Es war regnerisch geworden. Ich genoss die Fahrt zu Tanjas Wohnung, in einem Auto, das mir keinerlei Störungen anzeigte.
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.





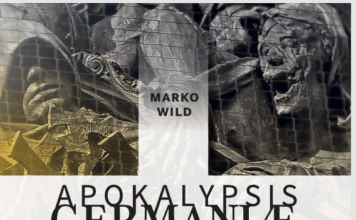

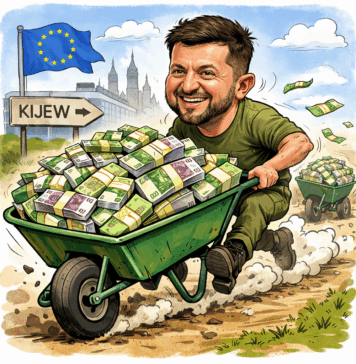

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.