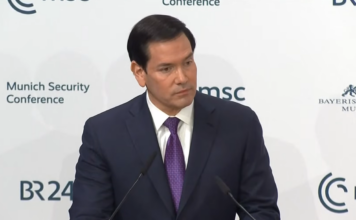Viele Bürger, die in der DDR lebten und das heutige Deutschland erfahren, denken zuweilen an die alten Zeiten. Trotz Stacheldraht und antiimperialistichem Schutzwall, bleibt auch das Gute lange im Gedächtnis. Gastbeitrag von Meinrad Müller
Erinnerungen sind keine Fakten, sondern Deutungen, lehrt uns Sigmund Freud. Das beste Beispiel dafür ist meine Cousine Gertrud, geboren 1961, sie lebt in Sonneberg/Thüringen. Nach der Wende sah man sich wieder öfter, zu Geburtstagen, an Feiertagen, zu Weihnachten oder an Neujahr. Und wie das dann ist, wenn man zusammensitzt, kommt man irgendwann auf früher zu sprechen. Nicht gleich und nicht jedes Mal, aber immer wieder.
Gertrud war kein politischer Mensch. Sie hat nie über den Staat geredet oder darüber, wie man etwas zu sehen hatte. Wenn sie erzählte, dann ging es um den Alltag, um das Einkaufen, um Preise, um das Anstehen und um die Läden. Und je öfter man ihr zuhörte, desto deutlicher wurde, dass sie vieles aus dieser Zeit nicht schlecht in Erinnerung hat. Im Gegenteil.
Beim Essen fing sie oft an. Sie sagte, darüber habe man sich keine großen Gedanken gemacht. Brot, Milch, Butter, Eier, Wurst, Kartoffeln, das war da. Man wusste, was man bekommt, und man wusste, dass es reicht.
„…weil es einfach so war“
Sie erzählte auch, dass es Dinge nicht immer gab. Kaffee zum Beispiel. Oder Orangen. Bananen schon gar nicht ständig. Wenn es die gab, sprach sich das herum, und dann stellte man sich an. Das fand niemand schön, aber es gehörte dazu. Und satt war man trotzdem.
Essen, sagte sie, sei kein Problem gewesen. Niemand stand an der Kasse und rechnete im Kopf, niemand überlegte, ob man sich das leisten kann oder nicht. Von dem, was man verdiente, ging nicht viel fürs Essen drauf, und darüber machte man sich keine Gedanken, weil es einfach so war.
Auch das Einkaufen selbst war nichts Besonderes. Man ging in den Laden im Ort, holte, was man brauchte. Ein Brötchen kostete fünf Pfennig, ein Brot unter einer Mark, die Milch 68 Pfennig, ein Ei ein paar Pfennig. Fleisch war teurer, klar, aber bezahlbar. Man wusste, was das kostet, und man wusste, dass es passt. Darüber wurde nicht geredet, weil es selbstverständlich war, sagte Gertrud.
Gertrud sagte, die Lebensmittel kamen aus staatlichen Betrieben. Niemand musste damit Geld verdienen, niemand musste etwas anpreisen oder besonders herausstellen. Essen war da, weil es gebraucht wurde, und gerade das Essen war billig, damit es sich jeder leisten konnte.
Heute, meinte sie, sei das alles anders. Heute müsse jedes einzelne Produkt etwas einbringen. Damals habe man darüber nicht nachgedacht. Wichtig sei gewesen, dass es da ist.
„Wurst war Wurst und Fleisch war Fleisch“
Vom Anstehen sprach sie auch. Dass man manchmal warten musste, aber nicht ständig und nicht für alles, sondern für bestimmte Dinge. Für Südfrüchte, für Kaffee, für Waren, die es nicht immer gab. Man stand zusammen, man redete miteinander, man wusste, wofür man wartet. Es war lästig, aber es war kein Drama.
Wurst war Wurst, sagte sie, und Fleisch war Fleisch. Man wusste, was man bekam. Oft kam es vom Fleischer im Ort, eingewickelt in Papier. Niemand drehte etwas um, niemand las Zutatenlisten. Das war nicht nötig.
Obst und Gemüse gab es nach Jahreszeit. Im Sommer anderes als im Winter. Das war normal. Erdbeeren im Januar kamen ihr damals gar nicht in den Sinn.
Über Hunger sprach sie nie, weil es den nicht gab. Gegessen wurde genug, und was übrig blieb, wurde nicht weggeworfen. Das kannte man so.
Auch auf dem Land, sagte sie, war alles da. Selbst kleine Orte hatten ihre Läden, und man musste kein Auto haben, um einkaufen zu können. Die Preise waren überall gleich.
Gertrud hat nie gesagt, dass alles gut war.
Aber sie sagte oft, dass vieles einfach funktioniert hat.
Und dass sie sich genau daran erinnert.
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.