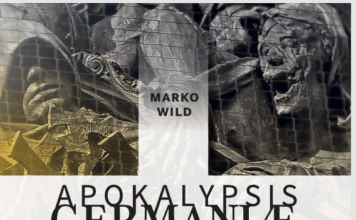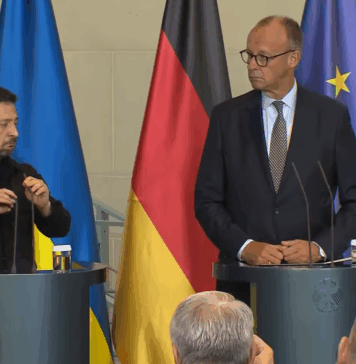I
29. Juni. Wollte ich meine Reise mit einer Oper, oder – um russisch zu bleiben – mit einer Ballettoper vergleichen, dann würden Sima und ich am Morgen jenes dritten Tages in die eigentliche Handlung einsteigen. Alles Bisherige wäre lediglich Ouvertüre gewesen. Die Fahrt durch das Baltikum und die Waldeihöhen – ein langes Intro in ruhigem Andante, das mit unserem nächtlichen Husarenritt durch Moskau erstmals schnell und fortissimo aufgetrumpft hatte, bevor am Höhepunkt der Klangkörper jäh zusammengefallen und – nach einer längeren Generalpause – verhalten ausgeklungen war. Wie doppeldeutig passte dazu der Name jener Straße, auf der die Dynamik so vollständig umgekehrt wurde: Schossee Enthusiastov.
Viele der späteren Themen, der Tempo- und Vortragswechsel, hatte dieser Eröffnungssatz bereits anklingen lassen; sie sollten im Verlauf der Reise immer wieder aufgegriffen und variiert werden. Wie man allerdings bei Nichtkenntnis eines Werkes bestenfalls vage vom Anfang auf sein Ende schließen kann, so blieb auch mir der gleichnishafte Sinn besonders unserer Moskau-Durchquerung im Moment noch verborgen.
Der erste Akt stand an. Und dieser gehörte zweifellos Sima. Es war 10:30 Uhr, als wir beide aufstanden. Obwohl wir nur fünf Stunden Schlaf gehabt hatten, fühlte ich mich gut erholt. Was vermutlich daran lag, dass sich auch gestern wieder eine Stunde durch Zeitverschiebung aus dem Staub gemacht hatte. Keine Ahnung, wann und wo das geschehen war. Die Frage, welche Zeit im Moment die richtige war, stellte sich mir jedenfalls bis Nowosibirsk immer wieder.
Das Wetter: 18 Grad, trocken, bedeckt. Prima, wir würden nicht schwitzen. Keiner von uns hatte bisher seine Kleidung gewechselt. Ich schaute mich um. Am Horizont, in der Richtung, in die wir weiter fahren würden, ragten blasse klotzförmige Konturen über die Brachebene. Vielleicht die Silhouette einer Stadt. Oder irgendeiner Industrieanlage. Trostlos. Nichts für das Auge. Nach meinem obligatorischen Kaffee brachen wir auf.
Für Sima war Moskau die erste wichtige Orientierungsmarke gewesen. Sein Rekord lag bei 29 Stunden. Wir hingegen hatten 41 Stunden bis hierher gebraucht. Dass diese deutliche Mehrzeit an ihm nagte, er deshalb unzufrieden war, ahnte ich nicht. Wie so vieles. „Wo geht’s als nächstes hin?“, fragte ich. „Wladimir“, entgegnete Sima, der jetzt Herr der Strecke war. Er kannte alles, jeden Abzweig, jede Umgehung. Ich hatte noch nie von einer Stadt namens Wladimir gehört und fand es komisch, dass eine Stadt einen Männernamen tragen konnte. Etwa so, als würde eine deutsche Stadt Johannes heißen. Ich hatte keine Ahnung, dass Wladimir schon seit dem Jahr 990 existierte. Dass es bis zum Mongolensturm eine der wichtigsten Städte der alten Rus, Hauptstadt und Machtsitz des bedeutendsten ostslawischen Fürstentums gewesen und hinsichtlich seiner Bedeutung erst später von Moskau abgelöst worden war. Ich hatte keine Ahnung, dass Wladimir eines der Zentren russisch-orthodoxer Kultur und die Wiege der großrussischen Sprache war. Keine Ahnung von Wladimir I., nach dem die Stadt benannt worden war, dem mächtigsten der alten Großfürsten (ca. 955 bis 1015). Der, nachdem er weite Teile der Rus vereint, aus Kalkül beschlossen hatte, das Heidentum abzuschaffen und eine einheitliche Religion einzuführen. Er soll Gelehrte aller großen Religionen an seinen Hof gerufen und ihnen aufgetragen haben, ihn von ihrer Theologie zu überzeugen. Den Vertreter des Islam soll er mit der Begründung abgewiesen haben, sein Volk sei ein sehr trinkfreudiges; ein Verbot von Alkohol würde es niemals akzeptieren.
Daraufhin entschied er sich für das Christentum und heiratete eine byzantinische Prinzessin. So wurde Russland orthodox und aus Wladimir I. ein „Heiliger“. Falls diese Geschichte stimmt, beweist sie, dass Wodka – ähnlich dem russischen Staatsadler – zwei Gesichter hat und in Russlands Geschichte mehr als eine ausschließlich negative Rolle spielte. Ohne das Wässerchen wären Europas östlichen Weiten möglicherweise schon früh islamisch geworden. Und ob das christliche Europa einem dreifachen muselmanischen Ansturm aus Südwesten (Sarazenen), Südosten (Osmanen) und Osten hätte stand halten können, darf zumindest bezweifelt werden. Doch was wusste ich schon von all dem? Nichts.
In Wladimir selbst, das wir ungefähr zur Mittagszeit erreichten, hätte ich ebenfalls nicht auf die Idee kommen können, gerade durch eine geschichtsträchtige Stadt zu fahren. Weder erhaschte ich einen Blick auf das Goldene Tor, noch auf die berühmte Mariä-Entschlafens-Kathedrale. Es war trübe und die Luft von Abgasen geschwängert. Was ich sah, war a) die Fernstraße mit mäßig dichtem Verkehr, b) ein leichter Regen auf der Frontscheibe, der sich eingestellt hatte und c) Bereiche inmitten des Stadtgebietes, bei deren Anblick mir der Gedanke kam, der Versuch der Zivilisationserrichtung sei hier auf dreiviertelstem Wege abgebrochen worden. Rodungsflächen mit Baumwurzeln mitten in der Stadt. Ohne städteplanerisches Konzept willkürlich irgendwohin gebaute Häuser. Zwischen diesen und der örtlichen Infrastruktur urplötzlich wieder Brachen. Birken, die aus halbverwilderten Gartenanlagen unter stahlträgernen Brücken heraufwuchsen. Rechts der Straße Plattenbauten, links schwarzbraune Bretterbuden. Bei bewölktem Himmel, Regen und dieselgeschwängerter Luft wirkte Wladimir auf mich alles andere als touristisch attraktiv oder historisch bedeutend. Was Wladimir an Attraktionen zu bieten hatte sah ich erst, als ich wieder zu Hause war – im Internet. Die Strafe für unsere Eile.
Sima wollte vorankommen. Er hatte mich nicht auf die Umgehungsstraße gelotst, sondern mitten durch die Stadt. Das war kürzer. Als wir einmal scharf links abbogen und sich unseren Augen eine schnurgerade, von zunehendem Wald gesäumte Fernstraße eröffnete, meinte er, jetzt hätten wir es geschafft; jetzt seien wir ganz sicher richtig. Der leichte Regen blieb. Meine Füße steckten nackt in ausgetretenen Halbschuhen. Es hatte auf 15 Grad abgekühlt. Bestes Wetter zum Autofahren. Nach 200 Kilometern wollten wir wechseln. Ich fuhr auf einen Rastplatz. Dort wurde der Müll in großen, flachen, oben offenen Stahlcontainern gesammelt. Das sah nicht gerade ästhetisch aus und stank trotz der kühlen Temperatur auch ziemlich. Und dennoch: Nirgendwo sonst lag Müll herum. Keine Flasche, nicht einmal ein benutztes Papiertaschentuch oder eine Zigarettenschachtel. Jeder Abfall befand sich da, wo er hingehörte. Ich dachte an Rumänien, wie dort die Wiesen und Straßenränder ausgesehen hatten und fand, die Russen seien doch ein ordentliches Volk. Überhaupt sah es vor allem überland sehr sauber aus.
Außer uns stand nur ein LKW mit langem Sattelauflieger auf dem Platz. Ich ging zur Fahrerkabine. Die Tür stand auf. Ein Mann mit kurzer Turnhose, schwarz-blauem Holzfällerhemd und bereits länger nicht gewaschenen Haaren aß gerade ein wenig von seinem Proviant. Hoch neben ihm saß – nein: thronte – hochzufrieden ein Mädchen. Anscheinend seine Tochter, noch keine zehn Jahre alt. Welch ein Abenteuer für ein Kind, dachte ich, den Vater auf seinen Touren begleiten zu können. Es war Ferienzeit. Der russische Sommer . . . heiße Wochen mit herrlichem Wetter, am Schwarzen Meer oder in der Datsche auf dem Land… 14 Wochen Sommerferien gibt man den Kindern. Fantastisch. Und nicht zu ihrem Nachteil! Russland ist das Land mit dem höchsten Akademisierungsgrad weltweit.
Ich fragte den LKW-Fahrer, ob er mir sein Handy borgen würde. Ich müsse kurz mit meiner Familie in Deutschland sprechen. Der Mann verstand mein radebrechendes Russisch und reichte mir sein Smartphone. Als ich damit nicht zurechtkam, half er mir. Aber vergebens, mit diesem Handy konnte man nicht nach Deutschland telefonieren. Ich bedankte mich. Auf dem Rastplatz wurde es ungemütlich windig und noch regnerischer. Zeit, weiter zu fahren. Sima übernahm.
II
Endlich konnte ich mir ein paar Notizen machen. Sinnierend starrte ich aus dem Fenster, um dann mit Bleistift etwas ins Büchlein zu kritzeln. Sima war neugierig.
„Was schreibst du““
„Meine Gedanken. Was wir so erlebt haben.“
„Ist für deine Reportasch?“
„Ja, vielleicht.“
„Was schreibst du? Zum Beispiel? Ich will es wissen!“
„Gerade habe ich etwas über den russischen Wald geschrieben.“
„Und? Was ist mit russische Wald?“
„Ich denke der Wald“ – und dachte dabei an die Waldaihöhen – t„ist Freund und zugleich Feind der Russen. Er versorgt sie mit allem, was sie brauchen. Er gibt ihnen Schutz, zu Essen und was sie gesund macht: Beeren und Pilze, Bau- und Brennholz, Kräuter, Fleisch, Honig, Wasser und so weiter. Aber er hält sie auch gefangen. Sie können nie weg. Er ist zu groß und zu stark. Die einfachen Menschen können ihn nicht besiegen. Er erobert sich alles zurück. Er ist zu … zu … gewaltig. Er ist wie ein Riese. Oder ein Gefängnis. So etwas eben.“
Sima schwieg. Doch ich hatte den Eindruck, diesmal sei es eher ein zustimmendes Schweigen.
Nach einer Weile meinte er:
„Mir gefällt nicht mit deine Reportasch … Ich will das nicht.“
Geht das schon wieder los, dachte ich und sagte, „es ist eben so. Ich hatte dir ja gesagt, dass ich Journalist bin.“
„Ja“, erwiderte er. „Aber ich habe nicht gewusst von deine Reportasch …“
Ich drehte das Radio etwas lauter, um ihm zu zeigen, dass ich nicht weiter darüber sprechen wollte. Außerdem war es gleich Um. Zeit für russische Nachrichten. Ich hörte immer konzentriert zu, um zu verstehen, ob ich der fremden Sprache irgendwelche Informationen abgewinnen konnte. Nachrichten wurden in ordentlichem, gut verständlichem Russisch gesprochen.
Hie und da schnappte ich Namen auf – Kanzler Merkel, Obama – und auch einige Worte, die man aus anderen Sprachen entlehnt hatte. Alles in allem schienen in Russland grundsätzlich dieselben Themen wichtig, wie in Deutschland: internationale Konferenzen, die Ukraine und vor allem Griechenland, immer wieder Griechenland. Griechenlands Finanzen, Griechenlands Ökonomie und so weiter. Am Ende der politischen Meldungen kamen die Wechselkurse zum Rubel. Interessanterweise war der erste Kurs jener zum Euro, nicht der zum Dollar, den ich in diesen Nachrichten überhaupt nicht hörte (in späteren schon). Ich sortierte die Information gedanklich in die Schublade internationaler Wirtschaftskrieg ein und dort in das Fach mit der Aufschrift Russland will sich vom Dollar lösen.
Der Regen hörte auf. Die Straße war super – breit und tadellos asphaltiert. Ein Genuss. Sima meinte gerade in hochzufriedenem Ton, ja, das seien die russischen Straßen, viel besser, als die in Deutschland, wegen des breiten Seitenstreifens, der ihm so gut gefalle, als er plötzlich einen freudigen Ruf ausstieß. „Da“, zeigte er durch die Windschutzscheibe, „meine Stadt!“ Ich verstand nicht. „Zweiundvierzig“, sagte er. „Auto ist aus Region Kemerowo. Meine Stadt auch zweiundvierzig.“ Der Aufbau der russischen Kennzeichen war mir schon immer ein Rätsel gewesen. Jetzt lüftete sich das Geheimnis. Nicht die Buchstaben, sondern der Zifferncode ganz rechts definierte die Herkunft. Ich fragte Sima aus. Nowosibirsk?
54.
Moskau?
77 und 99. Dazu noch 177 und 199, weil es inzwischen zu viele Autos gäbe.
Überhaupt würde das in mehreren Oblasts, also Verwaltungsbezirken, so gehalten. Nowosibirsk hätte also nicht nur die Kennzeichennummer 54, sondern auch 154. Kemerowo nicht nur 42, sondern auch 142 uns so weiter.
Ich fragte: Altai?
Sima wusste es: 22.
„Was ist das, vor uns, 152 …?“
„Nischni Nowgorod.“
„Und das, 116?“
An alle Codes könne er sich auch nicht mehr erinnern, aber das sei vermutlich Tatarstan. (Richtig, Sima.) Man merkte, dass er kreuz und quer in Russland herumgekommen war. Und noch eines wurde in diesen Gesprächen, die sich ums Fahren drehten, deutlich: Sima war ein Auto-Experte. „Das ist neue Infiniti – ist bessere Marke von Nissan, wie Lexus von Tayota“, klärte er mich auf. Oder: „Diese Truck in Russland wir nennen Fred.“ Er sprach „Fred“ wie einen deutschen Vornamen aus, mit weichem, rollendem R. Gemeint war „Freightliner“, ein us-amerikanischer Truck-Hersteller. Besonders aber bei russischen Fabrikaten entpuppte er sich als wandelnde Enzyklopädie. Ich war froh, dass wir uns auch über andere Dinge als meine Reportasch unterhalten konnten.
Wenn Sima fuhr, versuchte ich, unsere Strecke auf der Karte zu verfolgen. Doch seit einigen Kilometern konnte ich meine russische Straßenkarte nicht mehr gebrauchen. Bis kurz hinter Wladimir war sie im Maßstab 1:2 Millionen gehalten – der europäische Teil. Das ganze restliche Russland gab es auf der Rückseite nur noch im Maßstab 1:8 Millionen. Und da befanden wir uns jetzt. Weil also die Karte wegfiel und ich mich erst am nächsten Tag erinnern sollte, dass ich ja auch noch einen russischen Autoatlas dabei hatte, blieb mir viel Zeit, alles andere zu beobachten.
Auf einer Raststätte erblickte ich die Skulpturen zweier überdimensionaler silberner Hirsche aus Edelstahl. Jener mit Geweih erhob sein Haupt stolz über SIE, eine Hirschkuh, die sich mit eingeknickten Vorderläufen unter IHN beugte. Die Skulptur symbolisierte nicht nur männliche Dominanz und weibliche Ergebenheit sondern ging viel tiefer: Sie sprach von Herrschaft und Unterordnung. Der Herrschende segnet den Untertan, der Untertan empfängt Schutz und gibt dem Herrschenden dafür freiwillig Ehre. Beide brauchen einander. Ein Zustand vollkommener Regentschaft, wie es ihn womöglich noch nie auf dieser Erde gegeben hat. Und somit vielleicht nur die Sehnsucht eines bildenden Künstlers… Das war es, was ich spontan darin sah. Hätte ich gewusst, dass der Hirsch das Wappentier Nischni Nowgorods ist … Aber das sollte ich – wenn auch nicht jetzt – noch erfahren. Und zwar so, dass ich es nie wieder vergessen würde.
Nischni Nowgorod selbst ließen wir aus. Sima fuhr über die ganz neu gebaute und noch nicht vollständig freigegebene Umgehungsstraße. Kurz vor ihrem Ende mussten wir über eine Umleitung zurück Richtung Stadt fahren, bevor wir die M7 in Flugplatzqualität wieder unter unseren Reifen hatten. Wenig später erblickte ich eine einsame Tankstelle. Der Sprit war sehr günstig. Während ich knapp 65 Liter für 2000 Rubel (rund 32 Euro) tankte, rauchte Sima eine Zigarette und legte seine orangefarbene Decke wieder auf den Beifahrersitz. Wortlos hatte er beschlossen, dass ich wieder an der Reihe wäre. Mit jenem Diesel, den ich kurz nach der lettischen Grenze getankt hatte, konnte dieser hier nicht mithalten; der Durchschnittsverbrauch stieg um mehrere Zehntelpunkte, obwohl sich unsere Fahrweise nicht änderte. Wir waren jetzt mit 7,6 bis 7,7 Litern unterwegs. Was immer noch in Ordnung ging. Auf dem offenen Land passierten wir ein Industriegebiet. Vielleicht eine Raffinerie. Hohe Flammen züngelten aus den Fackelanlagen. Gewaltig. Sowjetisch.
Die Sonne kam heraus. Wir hörten russisches Radio und waren guter Dinge. Ich hatte noch nicht herausgefunden, mit welchem Humor man bei Sima punkten konnte. Zu oft und zu schnell war er eingeschnappt und hörte erst auf, mir etwas übel zu nehmen, nachdem ich ihm ausführlich erklärt hatte, warum dies oder jenes nur ein Scherz gewesen sei und er das bitte nicht so ernst nehmen solle. Besonders meine Neckerein, bestimmte seiner Aussagen in meiner Reportasch zu verarbeiten, reizten ihn, so dass ich mir diese Art von Scherzen bald verkniff. Andererseits war er selbst sehr angriffslustig. Er konnte ein Pokerface aufsetzen und einen trockenen, schwer durchschaubaren Humor an den Tag legen. Vor allem seine Überzeugung, dass alles, was ich seiner Meinung nach falsch machte (also mein bezüglich Russland falsches oder ungebührliches Verhalten – und das war seiner Meinung nach eine ganze Menge), typisch für Deutsche sei, ärgerte mich oft. Besonders wenn ich Dinge tat, von denen ich genau wusste, dass sie ganz und gar nicht typisch, sondern völlig untypisch deutsch waren, so dass auch oder gerade Deutsche sie unverständlich gefunden hätten.
Sima trieb es, wenn er wollte, soweit, dass quasi alles, was ich tat, falsch und typisch deutsch war. Denn er hatte aufgrund seines Wissensvorsprungs eine nicht geringe Deutungshoheit und spielte diese Karte gnadenlos aus. Ich revanchierte mich hin und wieder mit Bemerkungen zu seiner mangelhaften Aussprache des Deutschen und seiner russischen Herkunft – was typisch deutsch sei, könne er also gar nicht wissen. Das wiederum wollte er nicht gelten lassen. Oft hob er dann – völlig bar jeden Humors – zu einer weit ausholenden Verteidigungsrede an. Die stets auf der gleichen Argumentation aufbaute, dass nämlich ER in Russland NIEmals ein Russe gewesen sei, sondern sogar Deutscher im Pass stehen hatte. Aufgrund mehrerer solcher aus gescheitertem Humor misslungener Gespräche merkte ich, dass Sima sich eine eigene Identität konstruiert hatte, in die er sich je nach Bedarf mehr oder weniger beleidigt zurückziehen konnte. Er war weder Deutscher, noch Russe. Sondern Wolgadeutscher. Das war etwas Eigenes. Und vermutlich Besseres, besser als Russen und besser als Deutsche. Nur Wolgadeutsche konnten Wolgadeutsche wirklich verstehen und mit ihnen leben. Eher noch Russen. Aber niemals Deutsche. Deutsche seien einfach nur furchtbar.
Ich weiß nicht, ob es eine heimlich gärende Wut war, aber etwas trieb Sima immer wieder dazu, mich richtig derb zu verarschen. Wurde ich dann etwas laut, sagte er, das sei doch nur ein Scherz gewesen und ich solle mich doch nicht so aufregen. Manchmal merkte ich auch gar nicht, dass er mich verarschte, sondern glaubte ihm seine Geschichten.
So hatte er beispielsweise einmal ganz beiläufig die Bemerkung fallen lassen, im Ural könnten wir Waffen kaufen, falls wir welche bräuchten. Unterschwellig hatte dabei ein gefährlich-konspirativer Ton mitgeschwungen, der bei mir den Eindruck erweckte, wir würden möglicherweise welche brauchen, falls wir heil durch Russland kommen wollten. Ein anderes Beispiel für Simas Art zu „scherzen“ war folgendes. Ich aß einen Apfel, ließ anschließend das Fenster herunter und warf den Griebs mit einer schnellen Bewegung über das Autodach in den Seitengraben. Sima, der immer betonte, wie sauber Sibirien wäre und dass es einer ominösen Gruppe, die er Kapitalist nannte, noch nicht gelungen wäre, Sibirien zu vollzuscheißen, meinte, nachdem ich den Apfelrest aus dem Fenster geworfen hatte, er denke, es sei besser, es mir zu sagen: Eben hätte man im Radio (es war tatsächlich Nachrichtenzeit) gesagt, dass seit heute ein neues Gesetz in Russland gelte, laut welchem es verboten sei, Dinge während der Fahrt aus dem Fenster zu werfen. Putin wolle, dass Russland sauber bleibe. Wer erwischt würde, wie er etwas aus dem Fenster werfe, müsse mit sehr hohen Geldstrafen oder sogar Gefängnis rechnen.
Heute ist mir klar, was Sima bezweckte. Aber damals, in diesem Moment, in dem ich selbst nicht einschätzen konnte, was eben in den Nachrichten gesagt worden war, wo wir alle paar Kilometer an einer Polizeikontrolle vorbeikamen, die sehr genau darauf achtete, dass auch ja keiner die durchgezogene Mittellinie be- oder überfuhr, wo ich mit eigenen Augen sah, wie unerwartet sauber – also müllfrei – Russlands Straßen und seine Natur waren, da gelang es Sima durchaus, mir mit solchen „Informationen“ Angst einzujagen. Erst später begriff ich, dass das ein Spiel und der Preis, um den wir spielten, ein ganz anderer war.
Fast 500 Kilometer hatten wir heute bereits geschafft. Bis Kazan, der nächsten großen Stadt, waren es noch 400 Kilometer. Sima wollte wissen, wann ich denn in meiner ersten nowosibirsker Übernachtungsmöglichkeit erwartet würde. Als ich erwiderte, ich hätte mich für Donnerstag oder Freitag angekündigt, fragte er, wieso denn so spät? Es wäre doch möglich, dass wir schon am Mittwoch ankämen. Ob ich denn für diesen Fall etwas zum Schlafen hätte. Ich sagte, ich glaube nicht, dass wir es bis Mittwoch schaffen würden. „Narmalerweis geht schon“, beharrte Sima. „Man muss fahren, fahren. Immer fahren.“ Es wurde Zeit, etwas Grundsätzliches klarzustellen.
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.