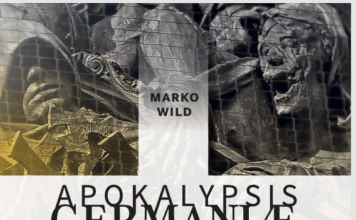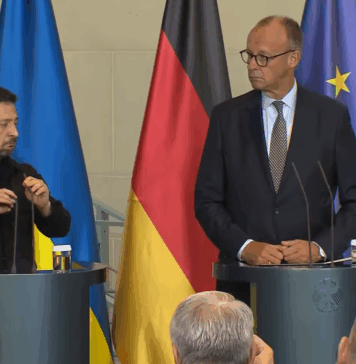III
Hinter Rēzekne begann der beste Abschnitt auf Lettlands Straßen: Die letzten 30 Kilometer E22 bis zur russischen Grenze. Ob Russland hier am Werk gewesen war? Denn die EU schien kaum etwas beizutragen zum lettischen Straßennetz. Die LKW-Schlange war kilometerlang. Doch wir konnten sie vollständig passieren. Halb Vier waren wir an der Grenze. Vielleicht 20 Autos vor uns. Das war der Plan gewesen. Sonntags gebe es weniger Grenzverkehr, hatte Sima gemeint. Dafür müssten wir uns unter Umständen auf strengere Kontrollen gefasst machen, weil den Grenzern keine endlose Warteschlange im Nacken sitze. Dazu kam es aber nicht. Die Letten wollten nur unsere Papiere sehen. Das ging schnell. An der russischen Grenze schaute man sich natürlich meine Ausrüstungskisten an, die Zollerklärung musste ausgefüllt werden und so weiter. Doch alles hielt sich im Rahmen. Sima erzählte mir anschließend, er habe sich bei einer Beamtin für mich eingesetzt. Pro Person waren – was ich nicht wusste – nur 50 Kilogramm Gepäck frei. Alles, was dieses Limit überschritt, hätte verzollt werden müssen. Sima hatte erzählt, ich sei Journalist und wolle eine Reportage über Russland schreiben; ich brauche einfach diese ganze Ausrüstung. Da habe man ein Auge zugedrückt und uns gute Reise gewünscht. Wie gut, jemanden dabei zu haben, der Russisch sprach und clever war. Von all meinen Grenzübertritten auf dieser Reise war jener erste der unproblematischste. Schon nach eindreiviertel Stunden fuhren wir auf Russlands Straßen ein, Simas geliebten russischen Straßen, von denen er mir schon öfters vorgeschwärmt hatte. Besonders der ausgebaute Seitenstreifen habe ihm bei plötzlichen Ausweichmanövern schon mehrfach das Leben gerettet. Und ja, die Straße war breit, aus grobem, sehr teerhaltigem Asphalt, vollkommen eben und ohne Löcher. Es würde sich gut darauf fahren lassen. Bald sollte Sima übernehmen. Ich suchte nur noch eine Stelle, wo wir Pause machen und etwas essen konnten. Nach wenigen Kilometern fand ich einen versteckten kleinen Platz, oberhalb der Straße, hinter der Böschung. Um uns herum eine Lichtung, dahinter dichter Wald. Die Natur sah bereits hier ganz anders aus, als in Lettland. Oder bildete ich mir das nur ein? Das musste einfach Russland sein! Soweit das Auge blicken konnte ein einziger Dschungel aus Huflattich, Farnen, Blumen, Kletten, Disteln, Birken, Nadelbäumen und hohem Gras. Eine undurchdringliche Wildnis.
Die M9, auf der wir bis Moskau bleiben würden, war als eine von Russlands wichtigsten Fernstraßen durchaus rege befahren. Vor uns lagen die Waldeihöhen. 400 Kilometer russischer Märchenwald. Dann noch einmal halb so weit bis zur Hauptstadt. Als Sima sich hinters Steuer setzte und beschleunigte, war er wie ausgewechselt. Er stürmte los, fuhr schnell, aggressiv, er drängelte und überholte. Ich mahnte ihn, nicht so dicht aufzufahren. Er ließ sich zurückfallen, doch ich sah, dass er es nicht mochte, so etwas gesagt zu bekommen. Und schon hing er dem Nächsten am Heck. Wieder appellierte ich, doch bitte etwas Abstand zum Vordermann zu halten. Es war das zweite und letzte Mal, dass Sima etwas, das er wohl als Tadel, wenigstens aber als Kritik verstand, schweigend hinnahm.
Doch es fraß in ihm. Bei der nächstpassenden Gelegenheit überholte er und trat auf’s Gas. 130, 140 Sachen. Auf Fernstraßen galt Tempo 90. Bis 100, 110 sollte es angeblich keine Probleme geben. Hatte ich gelesen. Doch selbst wenn einige Russen schneller fuhren, selbst wenn auch wir problemlos schneller fahren konnten – ich wollte gar nicht so schnell unterwegs sein. Ich wollte auf Verbrauch fahren. Mein Ziel war eine möglichst große Reichweite pro Tankfüllung. Denn ich hatte Zeit. Und da Zeit ja bekanntlich Geld war, konnte ich nur sparen, indem ich entspannt reiste. Also bat ich Sima, langsamer zu fahren.
Da verlor er die Fassung. Ähnlich wie damals, als ich ihn auf eine mögliche Spritkostenbeteiligung angesprochen hatte. Nur schlimmer. Er explodierte. Die Reise sei für ihn jetzt schon „fast beendet“, hob er an. Er habe es nicht glauben wollen als man ihn warnte, aber es sei tatsächlich wahr: Mit einem Deutschen zu fahren, sei ein Ding der Unmöglichkeit. (Das Narrativ vom unmöglichen Deutschen sollte Sima auf der Fahrt noch oft bemühen.) Was ich mir überhaupt einbilde. Er sei in seinem Leben wesentlich mehr Kilometer gefahren, als ich. (Spekulation, aber egal.) Und immer sei er unfallfrei geblieben. (Dito) Außerdem sei er älter als ich (er war auf den Tag genau sechs Monate älter) und schon allein deswegen hätte ich ihm nichts zu sagen!
Diesmal konterte ich hart. Ich sagte, das sei mein Auto, und ich würde bestimmen, wer wie mit meinem Auto fahren würde. Ob es ihm gefalle oder nicht. Ich sei gerne bereit, mir von ihm zeigen zu lassen, wie man sich in Russland verhielte. Aber wenn ich ihm mein Eigentum anvertraue, dann erwarte ich, dass er damit so umgehe, wie ich es sage.
Sima wich keinen Zentimeter zurück. Er gehe ja verantwortungsvoll mit meinem Auto um. Er fahre sogar vorsichtiger damit, als er mit seinem eigenen Auto fahren würde. Es sei völlig inakzeptabel, dass ich ihm alles vorschreiben würde. Wenn ich ihn für komplett Scheiße hielte, solle ich es sagen; dann würde er bis Nowosibirsk keinen einzigen Meter mehr fahren. Oder er könne da vorne aussteigen. Er würde jederzeit auch ohne mich an sein Ziel kommen. Kein Problem.
Jetzt musste ich seine Übertreibungen zurechtrücken. Dieser Mensch machte einem wirklich Mühe. Also fragte ich, wie er denn auf den Gedanken käme, ich würde ihn für komplett Scheiße halten. Das hätte ich nie gesagt und nie gedacht. Alles, was ich wollte, wäre, dass wir zusammen heil in Nowosibirsk ankämen. Außerdem läge mir an einem niedrigen Durchschnittsverbrauch, weil ich schließlich den ganzen Sprit bezahlen müsse. (Ich hoffte, er würde diesen Wink verstehen.) Er solle also einfach ein bisschen weniger aggressiv fahren, dann hätte ich keinen Grund und sicher auch keine Lust, ständig seine Fahrweise zu kritisieren.
Sima sagte nichts mehr. Vorerst. Die Grenze lag noch keine 20 Kilometer hinter uns. An der nächsten Tankstelle – einer Lukoil – fuhren wir raus. Wir brauchten Sprit, denn ich hatte in Lettland nur soviel getankt, dass es bis Russland reichte. Damals kannte ich mich mit russischen Mineralölkonzernen, Preisen und unterschiedlichen Dieselqualitäten noch nicht aus. Diese Lukoil hatte einen der besten Treibstoffe auf meiner gesamten Reise. Sima erklärte, man müsse zuerst bezahlen. Ich kaufte für 3000 Rubel Diesel zum Preis von 33,90 pro Liter. 88,5 Liter Diesel – wovon zehn Liter zurück in meinen angebrochenen Kanister wanderten. Danach lief der Bus perfekt. Der Boardcomputer zeigte im Verlauf von mehreren hundert Kilometern einem Durchschnittsverbrauch von 7,3 Litern und eine errechnete Gesamtreichweite von 1300 Kilometern an. Diese Werte sollte ich erst wieder auf der Heimreise erreichen, als ich an einer anderen sensationellen Tankstelle tankte, von der wir noch hören werden.
Sima kaufte im Shop zwei Eis am Stiel, gab mir wortlos eines und ging dann ein wenig auf dem Platz herum. Es sah aus, als wolle er sich nicht nur seine Beine, sondern auch seinen Ärger vertreten. Das Eis interpretierte ich als Versöhnungsgeste. Trotzdem weigerte Sima sich zunächst, weiterzufahren. Erst auf mehrfach gutes Zureden hin und das Versprechen, ihm nicht mehr groß reinzureden, ließ er sich darauf ein (oder besser: gab er mir noch eine Chance).
IIII
Die anschließenden Kilometer waren unvergesslich. Eine halbe Stunde lang breitete sich zu beiden Seiten der Straße ein Lupinenteppich aus, der oft tief in offene Lichtungen hinein reichte. Lila und grün. Es hörte und hörte einfach nicht auf. Ich konnte mich nicht satt sehen. Russischer Lavendel, dachte ich. Sima wies mich auf Birken mit gänzlich weißen Stämmen hin. Solche gäbe es in Europa nicht. Russland war für ihn also nicht Europa. Irgendwie schien er stolz darauf zu sein. Stolz auf Russland und auf alles, was dort anders (und seiner Meinung nach besser) war.
An den Straßenrändern standen gewaltige Pflanzen, die mich an etwas erinnerten, das wir als Kinder „Pferdekümmel“ (Wiesen-Bärenklau) genannt hatten und dessen Stiele man als Blasrohre verwenden konnte (Munition: Holunderbeeren). Mit ihren armdicken Stielen und den mächtigen weißen Blütendolden sahen sie aus, wie monströse Pusteblumen. Sie müssen teilweise über drei Meter hoch gewesen sein. Der Herkulesstaude genannte Riesen-Bärenklau stammt aus dem Kaukasus, kommt aber inzwischen in ganz Mitteleuropa vor. Er ist wegen seiner aggressiven Giftnesseln und -dämpfe nicht ungefährlich und verbreitet sich besonders entlang von Transitstrecken, weil sich seine großen, harten Samen gerne im Profil der LKW-Reifen verkeilen. Beim Anblick der Herkulesstauden kam mir der komische Gedanke, auch die Pflanzen würden sich den Dimensionen Russlands anpassen.
Einige Male fuhren wir an einfachen, hölzernen Verkaufsständen vorbei. Für mich war alles neu. Ich wusste noch nicht, dass man gebündeltes Birkenreisig, mit dem man sich in der Banja (Sauna) gegenseitig auspeitscht, in Russland überall an der Straße bekommt. Auch eingemachte Beeren, Pilze, Honig und frisches Obst wurden angeboten. Doch nirgends sonst in Russland, auch später im Ural nicht, sah ich so große und gut präparierte Wölfe und Bären, wie an der M9 in den Waldeihöhen. Es ist schon beeindruckend, an mit solch großen Fangzähnen bestückten, weit aufgerissenem Mäulern und solch stechenden, leblosen Blicken vorbei zu kommen. Der Wald, durch den man gerade fährt, wirkt dadurch gleich viel wilder und gefährlicher…
„Sima, ich muss unbedingt telefonieren. Ich muss meiner Frau sagen, dass alles in Ordnung ist, dass wir in Russland sind, dass es mir gut geht.“
Beim nächsten Rastplatz fuhren wir raus. Es gab dort eine Autowerkstatt, eine Gastiniza (Hotel) mit Sauna und Restaurant sowie ein Kafe (Kantine). Außerdem einige undefinierbare Gebäude. In der Autowerkstatt wollte man uns nicht helfen und verwies auf das Restaurant. Auch von dort kehrte Sima wenig später unverrichteter Dinge zurück und meinte, er werde jetzt nicht mehr fragen; es sei sinnlos. Keiner würde uns telefonieren lassen. Ich bat ihn, es mit mir zusammen noch im Kafe zu versuchen. Ein Кафе an Russlands Fernstraßen ist kein Café, in dem es Kuchen und Torte gibt, sondern eine Art Kantine, eine kleine Kafeteria. Wer unterwegs etwas Warmes essen will, geht da hinein. Kafes gibt es mindestens so viele, wie Tankstellen. Wir gingen also da hinein. Hinter der gläsernen Ladentheke stand eine junge Frau. Ich ließ all meinen Charme spielen. Während ich sprach und Sima übersetzte, sah ich der Frau unverwandt in die Augen. Ich trug ihr mein Anliegen vor, als würde ich sie gerne in die Oper einladen. Natürlich bekäme sie das Telefonat bezahlt, sagte ich und holte mein Portemonnaie heraus. Ich sprach von meiner Frau, von den Kindern, die alle so gerne nur kurz hören wollten, dass es mir gut gehe. Drei kleine Kinder. Dackelblick… Sie ließ sich erweichen. Zögernd, mit hochgezogenen Augenbrauen, reichte sie mir ihr Handy. Endlich. So groß die Freude, so kurz die Verbindung. Fünf Minuten vergingen wie im Flug. Über 300 Rubel. Ich gab ihr 500 und kaufte ihr vom Rest ein Fläschchen grünes Tabasco ab. Meine Erinnerung an die erste hilfsbereite Russin.
Sima fuhr etwas mehr als 250 Kilometer. Dann wechselten wir wieder. „Ich bin dein Sturman“, sagte er. „Weißt du was ist das, Sturman?“ Ungefähr, ja, nickte ich. Es gab eine russische Fliegeruhr, Modell „Sturman“.
„Sturman ich weiß nicht in Deutsch“, meinte er und beschrieb mir die Funktion eines Sturman. Wir einigten uns auf jemanden, der wichtig für den Fahrer war: ein Co-Pilot oder Navigator. Steuermann war auch nicht schlecht. Klang ja schon so ähnlich. Okay. Sima war jetzt also mein Sturman. Er hatte sich quasi selbst befördert … vom einfachen Passagier zum Navigator. Der Gedanke schien ihm zu gefallen. Mir war schon klar gewesen, dass es nicht beim Passagier bleiben würde. Unmöglich auf solch einer Tour. Egal. Hauptsache, Sima blieb verträglich.
Noch einmal gut 100 Kilometer. Es wurde Abend. Zeit für eine Pause. Links führte ein schnurgerader Sandweg in den Wald. Den nahm ich. Nach ein paar hundert Metern öffnete sich der Wald zu einer schier endlos weiten Graslichtung mit lockerem Bewuchs. Keine Wiese nach unseren Vorstellungen. Sondern wieder eine dieser russischen Ich-bin-tausendmal-stärker-als-du-Lichtungen mit Sumpflöchern, Disteln, Heidelbeerkraut, hüfthohem Gras, Totholz, dürren Bäumchen und – abgesehen von unserer Sandstraße – keinerlei Wegen. Ich musste austreten und wagte nicht, mich außer Sichtweite des Autos zu begeben. Bloß nicht die Orientierung verlieren. Es war unheimlich still. Und doch voller Geräusche. Vögel, Insekten – als wäre ich ein völlig unwichtiger Statist mitten auf der Bühne eines ungeheueren Amphitheaters, in welchem die Natur sich selbst aufführte. Ich stellte mir vor, Jäger zu sein und hier zu jagen. Wie klein man wäre… Beängstigend…
Zurück am Bus schlug ich vor, etwas zu essen. Wieder lehnte Sima ab. Diesmal lautete seine Begründung, er hätte nichts dabei, was er jetzt essen könne. Das verletzte und ärgerte mich. So wollte ich das nicht und so sollte es nicht sein. Das war falsch. Ich beschloss, ihm das nicht durchgehen zu lassen. „Sima“, sagte ich, „ich habe so viel dabei, du kannst von allem etwas abbekommen. Meiner Meinung nach isst man einfach zusammen, wenn man zusammen unterwegs ist. Das gehört sich so. Und ich dachte auch, in Russland wäre es normal, dass die Leute immer zusammen essen. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand ständig alleine essen will. Immer kurz vor oder kurz nachdem anderen. Ehrlich gesagt finde ich das ziemlich unhöflich und es hat für mich überhaupt nichts mit russischer Art und gemeinsam unterwegs sein zu tun, wie du dich verhältst.“
Sima hörte es sich ohne Erwiderung an.
Ich drehte noch etwas mehr auf, hielt mehr oder weniger eine Moralpredigt, psychologisierte, sagte, ich würde mich allein fühlen, so wie er sich mir gegenüber immer gebe, sagte, er würde sich an seine eigenen Worte nicht halten (denn Sima setzte große Stücke auf seine Ehrlichkeit) – von wegen in Russland wären die Menschen ganz anders zueinander. Er gebe gerade ein schlechtes Beispiel ab. Ja, er enttäusche mich, vielleicht hätte er aber auch ein ganz grundsätzliches Problem, vielleicht könne er überhaupt nicht mit jemandem zusammen essen. Vielleicht müsse er sich ständig absondern und alles von sich weisen, damit ihm ja keiner irgendwie zu nahe komme, vielleicht würde er meine Gesellschaft auch verachten, was ich dann als Beleidigung empfinden müsse und so weiter.
Sima starrte halb abgewandt noch oben in die Ferne. Als ich geendet hatte schwieg er eine Weile, dann sagte er: „Du chast schon Recht, narmalerweis wir essen zusammen.“ Ich breitete meine Verpflegung auf einer Decke aus und entgegnete, „gut, dann iss jetzt mit mir.“
Sima nahm folgende Lebensmittel an: eine Flasche Bier, eine sauere Gurke nach Spreewälder Art, ein Stückchen spanische Salami sowie eine dicke Scheibe Brot. Und siehe da – es funktionierte. Wir saßen da, aßen, tranken und unterhielten uns, wie es normale Menschen narmalerweis (eines von Simas Lieblingsworten) tun. Von da an aß er nur noch in Ausnahmefällen allein.
Nach dem Essen beratschlagten wir, wie wir es mit Moskau machen sollten. Sima meinte, narmalerweis sei es das Beste, Moskau nachts auf dem äußersten Autobahnring zu umfahren. Oben- oder untenherum wäre egal; aber tagsüber gebe es da immer viel Stau. Da würde man nur Nerven lassen und käme nicht voran. Ich fragte, ob es möglich wäre, auch durch die Stadt zu fahren. „Möglich vielleicht“, meinte er. „Aber Moskau chat viele kleine Straße, Gasse, Einbahn, gesperrt, auch nachts viel Verkehr. Du findest nie mehr heraus. Ich würde das nicht machen. Kostet Stunden, vielleicht chalben Tag. Am besten ist, Autobahnring. Dritter Ring. Bin ich immer so gefahren.“ Sima war sich sicher. Gab es einen Grund, ihm nicht zu glauben? Er war ja bereits in Moskau gewesen. So beschlossen wir, ein paar Stunden zu schlafen, um dann Moskau während der Nacht in Angriff zu nehmen. Nach einer Stunde des Versuches zu ruhen musste ich mir eingestehen, dass ich zu aufgeregt war. Das Bier wirkte nicht. Vor uns lag Moskau, die größte Stadt Europas. Sima hatte mir gehörigen Respekt vor der Metropole eingejagt. Auch er lag wach. Ich sagte, „Komm, lass es uns jetzt machen. Wozu noch länger warten.“ Ich brauchte ihn nicht zweimal zu fragen. Wie ich wollte er lieber jetzt als später aufbrechen. Allerdings aus einem gänzlich anderen, mir noch nicht bekannten Grund.
Die Sonne war untergegangen. Der dreiviertelvolle Mond schien am dunkelblauen Himmel. 22:30 Uhr. Wir lichteten den Anker. Alle Leinen los. Noch knapp 200 Kilometer bis Moskau. Dann hieß es: Auf guten Wind hoffen und heil durch die gefährlichen Passagen kommen. Waren wir fit? Ich wusste es nicht. Aber es trieb uns vorwärts. Unbändig.
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.