
I
Es öffnete die Tür … ein kurzgeschorener Jean Pütz. Mein erster Gastgeber hieß Gernot, war um die 60, von mittlerer Größe und mittlerer Statur. Die Reste seines schon von reichlich Silber durchsetzten Haares hatten sich – um dem Denken Raum zu verschaffen – aus der Stirn weitgehend zurückgezogen und bedeckten seinen Hinterkopf als störrischer Igel. Auf seiner Nase saß eine dunkelbraune, kreisrunde Hornbrille mit nicht allzugroßen Gläsern. Darunter wucherte ein fulminanter Schnauzbart. Aus marineblauen Schorts ragten wie zum Kontrast bleiche, muskulöse Beine; an den Füßen trug er Herrensocken und Badschlappen. Auch wenn man es nicht gewusst hätte – er sah aus wie ein Deutscher.
„Na, ging alles gut?“, fragte er in trockenem Bass. „Wie lange seid Ihr denn gefahren?“
„Sechs Tage.“
„Das ging ja. Da seid ihr ja gut vorangekommen. Ich kenne Leute, die brauchen dazu acht oder neun.“
„Und ich jemanden, der macht das in dreieinhalb Tagen.“
Gernot schaute mich an, als hätte ich einen schlechten Scherz gemacht.
„Ich kann leider nicht mehr besonders lange Auto fahren“, fuhr er fort. „Der Rücken… Seit ich den Unfall hatte, bin ich in Schmerzbehandlung. Wenn ich mal in Deutschland bin, dann immer per Flugzeug. Dunja und ich haben deshalb auch kein Auto mehr. Bis voriges Jahr hatten wir noch eines. Doch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man hier überall hin. Wo steht dein Auto? Fahr es hier rein, in den Hinterhof, das ist sicherer. Ich mache dir die Schranke auf. Hoffentlich hört der Portier, der hat nämlich manchmal keine Lust. Da muss man dann einfach hartnäckig sein und lange hupen. Soll ich dir was mit hochtragen?“
Wir mussten in den dritten Stock. Die Wohnung war mehr als ausreichend groß – für zwei oder drei Leute. Aber sie war keine 120 Quadratmeter groß, wie Gernot in einer Mail behaupte hatte. Eher 80. Eine klassische Dreizimmerwohnung mit Mittelflur, hohen Decken und recht engen Durchgängen, dunkel, mit Teppichen ausgelegt. Im Wohnzimmer Parkett. Gernot bat mich, meine Schuhe auszuziehen. Ich hatte nicht vorgehabt, die Wohnung mit Schuhen zu betreten. Gernot jedoch hatte schon auf Kulturpädagogik umgestellt. In Russland, erklärte er, sei es üblich, eine Wohnung barfuß zu betreten. Gut zu wissen, dachte ich. Dann stellte er mich seiner Frau vor. Die war Russin, etwa fünf Jahre jünger als er und zu Hälfte zentralasiatischer Abstammung. Sie hatte goldbraun gefärbte, glatte, schulterlange Haare und einen bronzefarbenem Teint. Hätten ihre braunen Augen nicht so müde und tief aus Höhlen mit dunklen Rändern geschaut, hätte man ihr die ehemalige Schönheit noch viel deutlicher angesehen. Sie trug ein knöchellanges, ärmelloses Kleid, streckte mir den Arm entgegen und hieß mich auf Englisch freundlich, wenn auch etwas unsicher willkommen. Ich bekam das Zimmer ihres Sohnes aus erster Ehe, der nicht mehr zu Hause lebte. Alles war ziemlich zugestellt. Zwischen Sofa und Bücherschrank war gerade genug Platz für eine Matratze. Ich stellte mein Gepäck ab und hängte, nachdem ich mich gewaschen hatte, die gläserne Tür zum Flur mit einer Decke zu, legte mich auf meine Campingmatte und schlief sofort ein.
Als ich erwachte, war ich allein. Ich fühlte mich erschöpft; die Tour steckte mir in den Knochen. Ich zog mir frische Kleidung an, ging ein wenig in der Wohung umher und sah aus einem Erkervorsprung mit französischem Fenster in den Hinterhof hinab. Ruhig war es hier. Die Eingangstür wurde aufgeschlossen. Gernot, in Leinen gekleidet, und die blumige Dunja – sie mochte es, ein wenig hippiemäßig auszusehen – kehrten zurück. „Ach, du bist schon wach. Wir waren schnell ein bisschen einkaufen. Dunja bereitet jetzt das Abendessen zu. Hast du Lust auf einen kleinen Spaziergang? Dann komm!“
Gernot ging mit mir einmal um den Block, um mich mit der Umgebung bekannt zu machen. Hinterher war ich wieder erschöpft. Ich hatte den Eindruck, Gernot breitete in diesen 20 Minuten sein gesamtes Wissen über das Viertel aus. Geschichte, Vorbesitzer und jetzige Eigentümer bekannter oder wichtiger Gebäude, in welchen Supermarkt man gehen müsse, wenn man gut und wohin, wenn man günstig einkaufen wolle, nach wem der kleine Park benannt war, welches Klientel hier abends unterwegs sei, wie Touristen von Gemüsefrauen abgezockt würden, welche Autos man Nachts auf der anderen Straßenseite zu sehen bekäme, dort, wo die teuren Lokale waren – nämlich vor allem Porsche, Lamborghini und Hummer H2 („in Nowosibirsk gibt es mehr Hummer, als in ganz Deutschland!“). Er zeigte mir den Iren, bei dem er gern etwas mit mir trinken würde, falls ich Lust hätte, erzählte, welche Disko erst letztens völlig überraschend abgerissen worden war und wer da ganz sicher dahinter stecke, welche Rolle die Mafia spiele, dass in Nowosibirsk eine Bank nach der anderen aus dem Boden schieße, wie das mit den Grundbucheinträgen sei, dass viele Besitzverhältnisse ungeklärt wären und in Nowosibirsk deshalb Goldgräberstimmung für Investoren und Spekulanten herrsche, welche Rolle die Deutschen bei der Stadtarchitektur gespielt hatten (unter anderen sei auch der Gründerzeit-Block mit seiner Wohnung von Deutschen erbaut worden) und so weiter und so fort. Mir dröhnte der Schädel, doch ich versuchte interessiert und aufmerksam zu bleiben. Gernot schien es zu gefallen, dass er einen Gesprächspartner hatte, der ihm zuhörte. Er gab den Flaneur und Universalgelehrten.
„Dunja und ich dachten“, sagte Gernot, als wir wieder in der Wohnung waren, „du könntest vielleicht eine Simkarte gebrauchen.“ Er hielt mir eine hin. „Da sind auch noch bisschen über 900 Rubel drauf – damit kannst du hier ewig telefonieren. Hier ist die Nummer dazu. Gib mir 500 Rubel, das passt dann.“ Unglaublich! Der Mann bedachte alles. Ich dankte ihm. Danach gab er mir Internetzugang. Ich schrieb einige Mails. Anschließend aßen wir. Dunja hatte Salat gemacht. Dazu gab es Croutons, Brot, Käse und Tee mit Honig. Zum Nachtisch wurde Nussgebäck gereicht, das man ebenfalls mit Honig aß. Der Honig schmeckte ganz wunderbar – anders, als jeder Honig, den ich bisher gegessen hatte. Viel würziger, beinahe, wie eine süße Medizin. Und er roch ätherisch, wie ein extrem luxuriöses Inhalationsmittel. Gernot meinte, der Honig wäre aus dem Altai. Ich bekam große Ohren und musste mich beherrschen, nicht soviel von dem Honig zu essen, dass es unhöflich erscheinen wäre. Er machte geradezu süchtig.
Dunja steuerte ab und zu eine kurze Bemerkung auf Englisch bei, doch die Unterhaltung fand überwiegend zwischen Gernot und mir statt. Denn Gernot sprach jetzt Deutsch. Überhaupt sprach fast nur er. Ich fand das etwas schade, weil das Dunja weitgehend ausgeschloss. Doch ich schrieb es Gernots Freude zu, sich in seiner Muttersprache unterhalten zu können.
Ich hatte den beiden eine gute Flasche Wein aus Deutschland mitgebracht. Gernot fragte, ob ich noch etwas anderes trinken wolle. Er hätte auch Sherry. Oder Rum. „Ja“, meinte ich, „dann lass uns mal den Rum versuchen.“ Gernot erzählte, dass er Rum-Fan sei, sicher auch ab und an Whisky trinken würde, aber Rum – also richtig guter Rum – wäre etwas ganz Besonderes. Wie jener hier – er stand auf und holte eine Flasche aus dem Schrank – den er aus einem Spezialitätengeschäft in Schleswig-Holstein habe. Er sei so und so viele Jahre alt und das merke man einfach. Gernot, der Kenner.
Also tranken wir Rum. Ich nahm mit, was mir gegeben wurde und fühlte mich zunehmend entspannter. Ein Dauerlächeln stellte sich auf meinem Gesicht ein. Es könnte nicht besser sein, dachte ich. Auch Gernot schien der Abend zu gefallen. Er drehte mächtig auf, sprach von Politik, seinem Ärger über die Feindschaft der deutschen Regierung gegen Putin, meinte, beim abgeschossenen Passagierflugzeug MH17 habe man eigentlich Putin treffen wollen, dessen Präsidenten-Maschine am selben Tag zu fast der gleichen Zeit ebenfalls den Abschussort überflogen habe; er sprach über sein Engagement in der Friedensbewegung der 1980er Jahre und wie er sich ausgeklinkt hätte, als die Szene sich aufgespaltet und in Teilen radikalisiert hatte, seine Verbindungen zum Chaos Comupter Club und so weiter und so fort. Gernot war Invalidenrentner und verbrachte einen Großteil seiner Zeit offenbar im Internet. Nie zuvor habe ich einen Menschen getroffen, der zu quasi allen politischen, sozialen und verschwörungstheoretischen Themen über ein derartig umfangreiches, echtes, eingebildetes oder vorgetäuschtes Wissen verfügte. Das machte den Abend kurzweilig, aber auch irgendwie anstrengend. Ich bat, noch einmal nach Hause telefonieren zu dürfen. In Deutschland war gerade Zeit zum Abendessen. So saß ich Mitternacht auf dem kleinen Balkon, der vom Schlafzimmer hinaus über die Flaniermeile ging, genoss die laue Sommerluft und beobachtete mit einem Auge unter mir das Treiben der Nowosibirsker Schicki-Micki-Szene, während ich zum ersten Mal lange und ohne Stress mit meiner Familie sprechen konnte. Botschaft: alles ist gut. Ich bin in den besten Händen.
II
Am nächsten Tag, Freitag, wollte ich in die Stadt. Ich brauchte dringend einen größeren Speicherchip für meine Kamera. Gernot nannte mir das geeignete Elektronikgeschäft. Und dann suchte ich natürlich Kartenmaterial. Vor allem von Nowosibirsk. Weder Tankstellen noch Buchhandlungen oder Kioske führten ein Sortiment von Wanderkarten oder Stadtplänen, wie man es aus Deutschland gewohnt ist. Gernot, der schon seit ein paar Jahren hier lebte, hätte selbst gerne einen Stadtplan gehabt. Beiden – Dunja und ihm – war schon zu Ohren gedrungen, dass es irgendwo eine kleine Druckerei geben sollte, die sich ganz auf Landkarten spezialisiert hatte. Dunja suchte im Internet. Schon nach kurzer Zeit hatte sie eine Adresse für mich. Mit Kugelschreiber skizzierte sie mir grob, wie ich dahin gelangen würde. Gernot bat mich, ihnen einen Stadtplan mitzubringen, falls ich fündig würde. Ich wunderte mich, dass Dunja und Gernot noch nie von selbst versucht hatten, sich etwas nach derartig Essentielles zu besorgen…
Nach dem Frühstück zog ich eine kurze Hose an und schwang mich auf’s Rad. Gernot warnte: „Sei vorsichtig! Die Leute hier sind Radfahrer nicht gewohnt. Keiner achtet auf dich!“
„Ich komme schon klar“, sagte ich lächelnd. Mit dem Rad in der Großstadt war ich, wie eine Forelle im Bergbach. Außerdem hatte ich es extra dafür mitgebracht. Keine Parkplatzsuche. Keine Sorge um das Auto und seinen Inhalt. Keine Gefahr, das Auto durch einen Unfall zu demolieren – mit all den hässlichen Folgen. Nein, das Rad war das beste Mittel, um flexibel und unabhängig zu sein. Egal, ob in einer fremden Stadt, oder der vertrauten. Nur hatte diese Weisheit die Russen offenbar noch nicht erreicht. Radfahrer waren in Russland so selten, wie Außerirdische. Irgendwann weit im vergangenen Jahrhundert – davon zeugten abgesenkte Bordsteinkanten oder kleine Rampen – mussten die Städteplaner zwar auch an Radfahrer, Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer gedacht haben. Doch das Ganze sah mittlerweile arg groblächtig und verhauen aus. Zudem lagen die Bürgersteige etwa 25 Zentimeter über der Straße und damit doppelt so hoch wie in Deutschland. Vielleicht mussten ihre Kanten als Flutbett dienen, wenn die Kanalisation versagte. Wo es Schrägen für Radfahrer gab, hatten diese einen viel zu steilen Winkel. Man hatte stets das Gefühl, ganz brutal über eine Stufe zu fahren. Kein Vergleich zu den sanften Absenkungen in Deutschland. Radfahren in Russland war hart für Material und Geist. Doch ich war auch eine harte Forelle.
Um zum Landkarten-Laden zu gelangen, musste man ein paar Kilometer die prächtigste und längste Straße Nowosibirsks Richtung Norden fahren – den Krasnij Prospekt. Krasnij bedeutete ursprünglich zuerst schön, wie mir ein junger Mann, den ich nach dem Weg fragte, mitteilte. Doch wegen der Oktoberrevolution sei alles, was krasnij im Namen trage, zur anderen Bedeutung von krasnij umgewandelt worden: Rot. Ich radelte also den Roten (eigentlich: Schönen) Prospekt hoch, auf dessen breitem Mittelstreifen sich Parkplätze und Bäume abwechselten. Wenn es dunkel ist, wird der Krasnij Prospekt zur Showmeile junger Russen, die zeigen wollen, wie cool sie sind. Aus einem überdimensionalen Cabrio wummern die Bässe, vorn lenken die Herren der Schöpfung während hinten heiße Russinnen mit Sonnenbrillen im Minikleid auf dem Heck der Karosse sitzen, die Füße auf den hinteren Sitzen, laut kreischend die Arme in die Nacht werfen und ihr langes Haar in der warmen Abendluft wehen lassen…
Doch jetzt war Tag. Vom Krasnij Prospekt bog ich rechts ab, in die Uliza Gogolja. Dann nach links in die kleinere Uliza Olgi Schilinoij und wieder nach rechts in die noch kleinere Uliza Demjana Bednowo. Hausnummer 55, Nowosibirskaja Kartografitscheskaja Fabrika. Von außen erinnerte das zweistöckige Gebäude mit seinem grauen Zementputz und den mit brauner Farbe gestrichenen Stahltüren an einen in die Jahre gekommenen Verwaltungstrakt einer LPG. Die Auffahrt war betoniert. Eine Beschriftung gab es nicht. Die wenigen Fenster zur Straßenseite waren mit Eisengittern versehen. Nur auf dem Dach prangte eine bunte Tafel mit einer Weltkugel. Ich betrat Nummer 55 durch eine offene Tür an der Seite, trat in Düsternis und eine angenehme Kühle. Auch im Inneren sah es sozialistisch mager aus. Ein uralter Schaukasten an der Wand stellte einige Druckerzeugnisse aus. Vorsichtig machte ich mich bemerkbar. Hinter einem Eisengitter-Tor erschien eine ältere Frau. Ihr strenges Kostüm ähnelte eher einer Uniform als einem zweiteiligen Dress. Ich sagte „Strastwuitje. Ja Nemnezki. Ja ne gawarim pa Russki charascho. U was jehst Kartyj?“
Die Frau schloss das Eisentor auf und bat mich wortlos in den Raum. Mein Rad, das ich aus Sorge, es könnte gestohlen werden, mit hereingenommen hatte, sollte ich beim Schaukasten stehen lassen. Anscheinend hatte sie meinen Hinweis, dass ich kein Russisch könne, entweder nicht verstanden oder es interessierte sie nicht, denn es folgte ein langer russischer Redeschwall. Sie winkte mir zu, ihr zu folgen und geleitete mich in das Allerheiligste: den Verkaufsraum. Er lag direkt an der Straße. Offenbar war ich durch einen Hintereingang herein gekommen. Zwischen hinter-der-Theke und davor gab es ein Klapp-Pult. Die Dame öffnete es, damit ich zu richtigen Seite gelangen konnte. Und da hatte ich es: alles, was das Herz begehrte!
Unter einer großen Glasvitrine lagen Stadtpläne von Nowosibirsk, Omsk, Tomsk, Barnaul, Bijsk, Gorno Altaisk, Irkustk und Krasnojarsk. Dazu politische, topografische und Straßen-Karten größerer Regionen. Sogar ein 80-seitiger topografischer Atlas der Republik Altai! Und diverse Autoatlanten der Russischen Föderation. Von Nowosibirsk gab es mehrere gefaltete Stadtpläne und einen in Buchform, Maßstab 1:10.000, in dem sogar die Hausnummern eingetragen waren. Genial! Das war mein Laden. Im muffigen Halbdunkel (die Dame machte mir extra Licht, damit ich die Karten begutachten konnte), studierte ich das Material, verglich, legte zur Seite, was ich definitiv kaufen würde und rang mit mir wegen anderer Karten, bei denen ich mir noch nicht sicher war. Die Stapel wurden immer größer. Die Dame war so streng wie ihr Kostüm. Wenn ich eigenmächtig nach der nächsten Karte griff, schimpfte sie. Nur sie war autorisiert, mir diese herunter zu reichen. Doch bei aller Strenge war sie war auch sehr freundlich und bemühte sich nach Kräften, mir jede Auskunft zu erteilen. Die Verständigung geriet etwas schwierig, denn die Frau sprach kein einziges Wörtchen Deutsch oder Englisch. Und wenn sie einmal loslegte, dann wie gesagt so ausführlich, dass ich ihr nicht folgen konnte. Dass ich Deutscher war, löste etwas bei ihr aus. Sie schien irgendeine positive Erinnerung damit zu verbinden, denn einmal lächelte sie vielsagend.
Am Ende verließ ich den Laden mit einem ganzen Stapel Karten für fast 1000 Rubel und genehmigte mir am nächsten Kiosk als Krönung dieses sehr gelungenen Unterfangens ein Eis am Stil der Marke Moskowskoje. Das wurde meine Sorte. Sie erinnerte mich an das Eis am Stil, welches es in meiner Kindheit in der DDR gegeben hatte: ganz dünne Schokolade und pures, weißes, nicht übermäßig sahniges Eis. Dieses Eis war keine fettglasierte Zuckerbombe, keine halbe Mahlzeit, sondern wirklich genau das, was es sein sollte – eine kleine Erfrischung. Und es war edel verpackt: in richtig dicker, verschweißter Aluminiumfolie! Hier in Nowosibirsk am Kiosk beim geografischen Kartenladen kostete es nur 35 Rubel. Nirgendwo sonst bekam ich es später für diesen Preis.
Das nächste, was ich erledigen musste, war, Sima anzurufen. Wer weiß – vielleicht brauchte ich ihn ja. Außerdem hatte er mir eingebläut, ich solle mir unbedingt eine örtliche Sim-Karte besorgen und ihm dann meine Nummer mitteilen. Beim ersten Versuch war jemand anders am Telefon und sagte mir, Sima sei unterwegs. Ich schickte ihm eine sms. Wenig später kam der Rückruf.
„Sima hier“, grüßte er in einem Ton, als hätten wir uns das letzte Mal vor einem Jahr gesehen, aber er würde sich schon noch an mich erinnern.
„Hallo Sima. Ich bin ich jetzt erreichbar.“
„Und? Geht dir gut?“
„Ja, alles okay. Ich bin gut untergekommen.“
„Wenn was ist – vielleicht mit Auto – oder du brauchst Hilfe, rufe mich an!“
„Alles klar, danke. Weißt du schon einen Termin wegen deinen Zähnen? Wie lange es dauert und wann du alles erledigt haben wirst?“
„Nein, kann man noch nicht sagen. Narmalerweis mindestens vier Wochen. Aber kann schon länger dauern. Rufst du in paar Wochen noch mal an. Dann ich weiß mehr.“
„Alles klar. So machen wir’s. Bis dann.“
„Ja, wiedersehen.“
Ich radelte zurück und warf einen Blick in eine wirklich sehr kleine Kapelle, die ein paar Meter unterhalb der Oper auf dem Mittelstreifen des Krasnij Prospekt errichtet worden war. Gernot hatte erzählt, sie gelte als der geografische Mittelpunkt Russlands; von da aus sei es ebenso weit nach Osten, wie nach Westen. Das Innere war reich geschmückt, mit Ikonen, Gold und Fresken, einem kleinen Altar und hölzernen Schautischen. Außen um die Kapelle herum brauste der Nowosibirsker Cityverkehr und schenkte ihr keine Beachtung. Drinnen bekreuzigten sich Frauen, die ein Tuch über die Haare gelegt hatten, vor einem Heiligenbild, zündeten dünne Kerzen an und machten eine kleine Verbeugung.
III
Zurück bei Gernot hatte sich etwas geändert: Dunjas Sohn war da. Sascha – jung, groß und schlank, mit dem blonden Wuschelkopf Robert Redfords – war ein sehr gutaussehender Mann. Er begrüßte mich respektvoll und fragte auf Englisch, wie es mir mit dem Rad ergangen sei. Ich meinte, das wäre eine ganz hervorragende Lösung für Nowosibirsk und er müsse das unbedingt auch einmal versuchen. Ob er denn ein Rad habe? Nein. Er könne sich doch eines kaufen, meinte ich. Sascha druckste herum. Ich fragte, ob ich ihm mal meines borgen solle. Dann könne er selbst ausprobieren, wie wunderbar das sei. Sasche meinte, um ehrlich zu sein, er könne gar nicht Radfahren. Ich sagte „Oh“, weil ich nicht wusste, was ich darauf erwidern sollte. Man erwartet das einfach nicht. Als würde einem ein Deutscher gestehen, er könne nicht schwimmen. Damit war das Thema einstweilen beendet. Zurück blieb das schale Gefühl, Sascha in eine peinliche Lage gebracht zu haben.
Später sprach er länger und heftig mit seiner Mutter in der Küche. Gernot wirkte angespannt. Oder verdrossen. Oder verärgert. Ich konnte es nicht genau ausmachen. Mit abgesenkter Stimme fragte ich ihn, ob alles in Ordnung wäre. Gernot stöhnte auf und rollte mit den Augen. Sascha war von seiner Frau hinausgeworfen worden. Die beiden trennten sich gerade. Nun suchte er eine neue Wohnung. Es war auch noch ein Kind da, das vermutlich bei der Mutter bleiben würde. Dummerweise belegte ich gerade Saschas Zimmer. Gernot meinte, es ärgere ihn, dass Dunja ihn jedes Mal ausschlösse, sobald es um ihre internen Familienangelegenheiten ginge. Dann würde sie mit ihrem Sohn nur auf Russisch sprechen, es würde heimlich getan, getuschelt, es würden seltsame Blicke gewechselt und so weiter. In solchen Momenten merke er, dass er nicht wirklich dazu gehöre.
Sascha schickte sich an, zu gehen. Ich fragte ihn, wo er arbeite. Er erzählte, dass er bei einem Telekommunikationsunternehmen im mittleren Management tätig sei. Und von seinen Arbeitszeiten, die ihm für mein Empfinden kaum Zeit für seine Familie ließen. Oder aktuell eben nicht viel Zeit, sich düsteren Gedanken hinzugeben. Nachdem er gegangen war, herrschte zwischen Dunja und Gernot ein anderer Tonfall. Während ihrer zu flehen schien, du musst das verstehen, es ist nun mal so und es wird sich auch nie ändern, aber das ist das, worauf du dich eingelassen hast, klang Gernot kalt und hart. Mit Dunja sprach er wie ein Vorgesetzter, in dessen distanziertem Verhalten sich der Rangunterschied zu einem niederen Mitarbeiter ausdrücken sollte. Ich sah, dass er verletzt war, dass er an diese neue Ehe Erwartungen gehabt hatte, die nicht erfüllt worden waren. Keiner wollte seinen Rat. Keiner zog ihn ins Vertrauen. Das schmerzte ihn. Er war allein. Aber er war auch schon an die Sechzig, hatte gelernt, mit solchen Zurückweisungen umzugehen und war – hier in der Fremde – immer auch in der abhängigen Position.
Dennoch gaben sich beide Mühe, den Abend davon nicht beherrschen zu lassen. Wir aßen zusammen, mein Wein wurde geöffnet und gelobt. Ich zeigte Gernot meine Landkarten und Stadtpläne und bat ihn, sich diejenigen auszusuchen, die er gebrauchen konnte. Ein Geschenk. Er nahm zwei oder drei. Unter anderem eine Karte der Republik Altai. Dabei erzählte er, dass er und Dunja dort eine Blockhütte hätten. Dann zeigte er mir Fotos von seinem, wie mir schien, eigentlichen, seinem glücklichen Leben: er mit Dunja im nördlichen, verschneiten Altai, am zugefrorenen Fluss Bija, mit Pelzkragenjacke und einem Fisch in der Hand. Traumhaft. Das lockerte die Stimmung. „Wenn du hinfährst … das wird wunderschön, das garantiere ich dir!“, meinte er auf Englisch. Und Dunja ergänzte: „Keine Mücken im Altai!“
„Warum nicht?“
Dunja hob die Augenbrauen. Gernot sagte:
„Zu hoch…“
Dann wechselte er in einen Tonfall, der signalisierte, es nun sei der Zeitpunkt gekommen, etwas Wichtigeres zu besprechen:
„Wir wollten dich etwas fragen. Dunja und ich müssen morgen nach Tomsk. Dunja hat dort an der Universität studiert. Morgen ist ihr 25-jähriges Absolvententreffen. Falls du Lust hast, kannst du mitkommen. Wir können auch den Linienbus nehmen, aber…“
„Nein, nein, kein Problem“, warf ich ein. „Ich kann Euch fahren. Wir fahren alle mit meinem Bus. Da sind wir viel unabhängiger … Ich meine, wenn Euch das recht ist…“
„Ja, das wäre natürlich eine Erleichterung. Du bist also eingeladen. So kannst du auch gleich noch eine interessante Stadt kennen lernen. Tomsk war die eigentliche, alte Hauptstadt Sibiriens. Tomsk hat auch die älteste und beste Universität. Gegründet von Deutschen. Wie im Prinzip jede Universität in Sibirien. Tomsk ist in mancher Hinsicht viel schöner, als Nowosibirsk. Aber das wirst du ja dann sehen.“
„Wie weit ist es denn bis Tomsk?“
„Ungefähr 250 Kilometer. Ich würde natürlich den Sprit übernehmen.“
„Also von mir aus sehr gerne. Ich bin dabei,“ sagte ich.
Alle waren zufrieden. Gernot schien erleichtert. Seine Laune besserte sich. Auch Dunja beteiligte sich heute mehr am Gespräch. Als wir auf meinen Begleiter Sima zu sprechen kamen und ich erwähnte, dass er aus P…..jewsk stammte, rief sie aus, „Oh, City of Banditos!“
Im Spaß erzählte ich Gernot von Simas schwerem Koffer, der während der Reise niemals geöffnet worden war. Gernot, der einen starken Hang zum abgründigen Denken hatte, schlussfolgerte sofort, dass mit dem Koffer etwas faul gewesen sein musste. Ich meinte, „was sollte man denn nach Russland schmuggeln? Sicher kein Gold oder Silber.“ Allerdings konnte es vom Gewicht her nur etwas mit einer hohen Dichte gewesen sein. Metall lag nahe. Gernot meinte, „vielleicht Munition.“ Da fiel mir ein, dass Sima einen Bekannten erwähnt hatte, der Sportschütze war. „Da haben wir es doch!“, stieß Gernot aus. „Bestimmte Munition – z.B. für Kurzwaffen – ist nämlich in Russland nicht frei verkäuflich.“ Damit war das für Gernot gebongt: Sima hatte Munition geschmuggelt. Mit solchen Spekulationen verging der Abend. Als mein Wein aufgebraucht war, tranken wir Wodka. Gernot war wieder in seinem Element. Er erzählte mir von der 18-bändigen, geheimen Encyclopedia Sibiria, die zwischen Siebzehnhundertnochwas und Achtzehnhundertnochwas von deutschen Forschern in Latein verfasst worden war. Da sie sehr detaillierte Beschreibungen über Gold- und Edelsteinvorkommen enthielt, sei sie von den Bojaren, jenen – wie er sie nannte – ersten Oligarchen, und später vom Zaren beschlagnahmt, unter Verschluss gehalten und erst nach dem Umsturz von 1991 in der Eremitage wieder entdeckt worden.
Gernot erzählte von Waffenverkäufen an die rechte Szene in den 1970er Jahren durch US-Soldaten, die zu früh ihren Sold vertrunken hatten und anderweitig zu Geld kommen mussten. Er referierte über die Afghanistan-Connection – jene hochrangigen Offiziere, die am Hindukusch gedient hatten, die nun an entscheidenden politischen Schaltstellen saßen und die deutsche Außenpolitik mit ihrem Blick durch die Kriegsbrille angeblich radikalisierten. Er erzählte von Gerüchten, die ihm zu Ohren gekommen seien, dass nämlich eine Delegation der Bundesregierung an just diesem Wochenende in Nowosibirsk eintreffen würde. Offiziell als Begegnung mit Russlanddeutschen getarnt, in Wahrheit, um mit Vertretern der russischen Opposition die Chancen einer Farbenrevolution gegen den Kreml zu erörtern. Dunja konnte nur noch wenig beitragen und wurde immer stiller. Gernot sprach über die sogenannten Sieben Bankiers, russische Großbanker und Oligarchen, die ihre Karriere unter Gorbatschow begonnen hatten und deren Einfluss bis heute sehr groß ist; er sprach über 20, 30 Jahre alte Pädophilen-Netzwerke bei der Diakonie, die er erkannt und aufgedeckt haben wollte und über die Einflussnahme von Justiz und Beamtenapparat, um Mißstände nicht an die Öffentlichkeit dringen zu lassen, das Abflauen seines Engagements, das Scheitern seiner Ehe, seinen schlimmen Unfall, die sich seitdem verschlimmernden Koordinationsschwierigkeiten in seinen Händen, weswegen er kaum noch Gitarre spielen könne, das Leben mit den Schmerzen, eine neue, sehr wirkungsvolle Schmerztherapie mit Schlangengift und darüber, dass es kaum Ärzte gäbe, die in der Behandlung mit Schlangengift Erfahrung hatten.
Auch Dunja lebte mit Schmerzen. Außerdem litt sie an fortschreitender Vergesslichkeit. Einst hatten sie und ihr früherer Mann ein Kleinunternehmen gehabt, das Büromöbel herstellte. Als der Erfolg im aufstrebenden Nowosibirsk zu groß geworden war, hatte die Mafia in Gestalt eines Konzernes angeklopft, um die Firma zu übernehmen. Doch Dunja und ihr Mann wollten nicht verkaufen. Daraufhin begann das schmutzige Spiel. Man setzte die Firma unter Druck und verbreitete unwahre Gerüchte. Dunjas Ehe zerbrach. Die Firma ging wie gewünscht an den großen Konzern über. Danach war Dunja körperlich und mental am Ende. Sie erzählte, sie würde immer noch mit der Justiz um Rehabilitation kämpfen – wenigstens für ihre Ehre, um die falschen Gerüchte, die ihr bis heute nachhängen, aus der Welt zu schaffen. Mit Medikamenten versuchte sie, den Fortgang ihrer Demenz zu verlangsamen.
Gernot und Dunja hatten sich übers Internet kennen gelernt. Sie hatten monatelang gechattet und festgestellt, dass da wohl eine nicht zu leugnende „Schwingung“ vorhanden war. Geheiratet wurde, ohne dass sich die beiden wirklich kennen gelernt zu hatten. Meinem Eindruck nach war diese Ehe für Gernot auch ein Möglichkeit, um Deutschland den Rücken kehren zu können. Von seiner Pension ließ es sich in Russland gut leben. Die Miete für die Wohnung war angeblich „sehr günstig“.
Ich betrachtete Gernot beinahe schon wie einen väterlichen Freund, als ich mich zum Schlafen verabschiedete. Zu früh, wie sich herausstellen sollte.





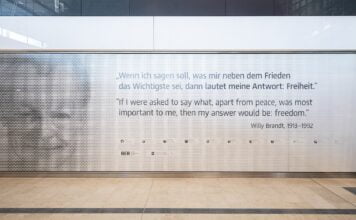



Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.